„Empirismus“

David Hume
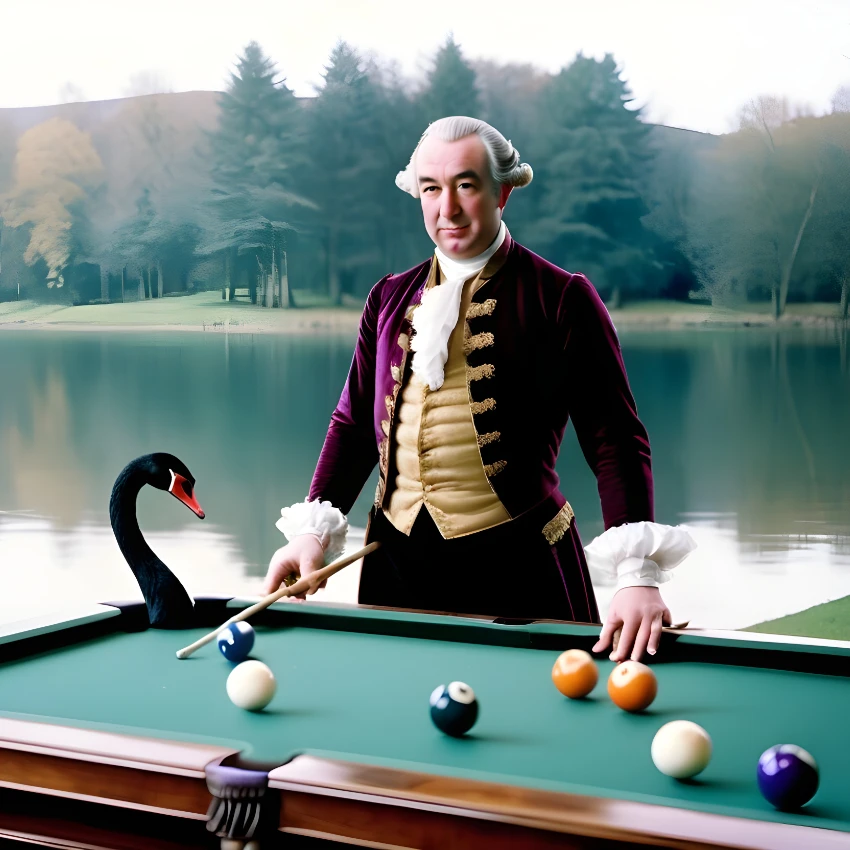
Inhalt
Biografie
Zitate
Original Textauszug
Sinneseindrücke und Vorstellungen:
Jedermann wird bereitwillig zugeben, dass ein beträchtlicher Unterschied zwischen den Perzeptionen [Wahrnehmungen] des Geistes besteht, wenn ein Mensch den Schmerz übermäßiger Hitze empfindet oder die Wohltat angenehmer Wärme und wenn er sich nachher diese Wahrnehmung ins Gedächtnis zurückruft oder sie in der Einbildungskraft vorwegnimmt. Diese Fähigkeiten können die Sinneswahrnehmungen nachahmen oder kopieren, jedoch niemals die Stärke und Lebendigkeit der ursprünglichen Empfindung völlig erreichen. Wir können höchstens von ihnen sagen – selbst dann, wenn sie mit größter Kraft auftreten –, sie stellen ihren Gegenstand derart lebendig dar, dass wir ihn fast zu sehen oder zu fühlen meinen: Aber außer dass der Geist durch Krankheit oder Wahnsinn gestört ist, können sie nie einen solchen Grad der Lebendigkeit erreichen, dass diese Perzeptionen gänzlich voneinander ununterscheidbar wären. […]
Wir können beobachten, wie ein gleicher Unterschied durch alle anderen Perzeptionen des Geistes hindurchgeht. […]
Wir wollen deshalb alle Perzeptionen des Geistes in zwei Klassen oder Arten unterteilen, die durch ihre verschiedenen Grade der Stärke und Lebendigkeit unterschieden sind; die schwächsten und am wenigsten lebhaften werden gemeinhin Gedanken (thoughts) oder Vorstellungen (ideas) genannt. Für die andere Art fehlt in unserer Sprache wie in den meisten anderen ein besonderer Name, vermutlich, weil es außer für philosophische Zwecke nicht erforderlich war, sie unter einen allgemeinen Ausdruck oder Namen zu fassen. Wir wollen uns deshalb erlauben, sie Eindrücke (impressions) zu nennen, wobei wir dieses Wort in einem vom üblichen etwas abweichenden Sinne gebrauchen. Unter der Bezeichnung Eindruck verstehe ich also alle unsere lebhafteren Perzeptionen, wenn wir hören, sehen, fühlen, lieben, hassen, begehren oder wollen. Eindrücke sind von Vorstellungen unterschieden, welche die weniger lebhaften Perzeptionen sind, deren wir uns bewusst sind, wenn wir auf eine der oben erwähnten Wahrnehmungen oder Gemütsbewegungen reflektieren.
Nichts erscheint wohl auf den ersten Blick unbegrenzter als das Denken des Menschen, das sich nicht […] in den Grenzen von Natur und Wirklichkeit halten lässt. Ungeheuer zu ersinnen und nicht zueinander passende Gestalten und Erscheinungen miteinander zu verbinden kostet die Einbildungskraft nicht mehr Mühe, als sich die natürlichsten und vertrautesten Gegenstände vorzustellen; und während der Leib an einen Planeten gefesselt ist, auf dem er unter Schmerzen und Beschwerden einherkriecht, kann uns das Denken im Nu in die entlegensten Regionen des Universums tragen – oder sogar über das Universum hinaus in das grenzenlose Chaos, wo sich die Natur, wie man annimmt, in totaler Unordnung befindet. Was niemals gesehen wurde und wovon man niemals gehört hat, kann dennoch vorgestellt werden, und nichts übersteigt die Macht des Denkens, mit Ausnahme dessen, was einen absoluten Widerspruch enthält.
Doch obgleich unser Denken diese unbegrenzte Freiheit zu besitzen scheint, werden wir bei näherer Prüfung finden, dass es in Wirklichkeit in sehr enge Grenzen eingeschlossen ist und dass diese ganze schöpferische Kraft des Geistes nur in dem Vermögen besteht, das uns durch die Sinne und Erfahrung gegebene Material zu verbinden, zu transponieren, zu vermehren oder zu verringern.
Denken wir uns einen goldenen Berg, so verbinden wir nur zwei vereinbare Vorstellungen, Gold und Berg, die uns von früher bekannt sind. Ein tugendhaftes Pferd können wir uns vorstellen, weil wir uns aus unserem eigenen Gefühl die Tugend vorstellen können; und diese können wir mit Gestalt und Aussehen eines Pferdes in Verbindung bringen, das ja ein uns vertrautes Tier ist. Kurz gesagt, der ganze Stoff des Denkens ist entweder aus der äußeren oder der inneren Sinnesempfindung […] abgeleitet: Aufgabe des Geistes und des Willens ist einzig und allein ihre Mischung und Zusammensetzung. Oder, um mich philosophisch auszudrücken: Alle unsere Vorstellungen oder schwächeren Perzeptionen sind Abbilder unserer Eindrücke oder lebhafteren Perzeptionen.
David Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding / Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Übersetzt und hrsg. von Herbert Herring. Reclam, Stuttgart 1967. S. 31, 32-34
Eine gewohnheitsmäßige Verbindung:
Um mit dem Begriff […] des notwendigen Zusammenhanges gänzlich vertraut zu werden, wollen wir den ihm zugehörigen Eindruck untersuchen; um diesen mit größerer Sicherheit zu finden, wollen wir alle Quellen untersuchen, denen er möglicherweise entspringen kann.
Blicken wir auf die uns umgebenden Außendinge und betrachten wir die Wirksamkeit der Ursachen, so sind wir in keinem einzigen Falle in der Lage, […] einen notwendigen Zusammenhang zu entdecken, irgendeine Eigenschaft, welche die Wirkung an die Ursache bindet und die eine zur unausbleiblichen Konsequenz der anderen macht. Wir finden nur, dass die eine in Wirklichkeit tatsächlich auf die andere folgt. Den Stoß einer Billardkugel begleitet eine Bewegung der zweiten. Das ist alles, was den äußeren Sinnen erscheint. Der Geist erlebt keine Empfindung, keinen inneren Eindruck von dieser Folge der Gegenstände: Demzufolge gibt es in keinem einzelnen, bestimmten Falle von Ursache und Wirkung etwas, das auf die Vorstellung der Kraft oder des notwendigen Zusammenhanges hinwiese. […]
Ich wage es, den Satz als allgemeingültig und keine Ausnahme duldend aufzustellen, dass die Kenntnis dieser Beziehung in keinem Falle durch Denkakte a priori* gewonnen wird […]. Man lege einem noch so klugen und fähigen Menschen einen Gegenstand vor; ist ihm dieser gänzlich fremd, wird er – trotz sorgfältigster Untersuchung seiner sichtbaren Qualitäten – nicht fähig sein, irgendeine seiner Ursachen oder Wirkungen zu entdecken. […]
Würde man uns irgendeinen Gegenstand zeigen und würden wir aufgefordert, die von ihm ausgehende Wirkung zu nennen, ohne frühere Beobachtungen zu Rate zu ziehen, auf welche Weise – so frage ich – muss der Geist dabei verfahren? Er muss sich ein Ereignis erfinden oder ausdenken, das er dem Gegenstand als dessen Wirkung zuschreibt, und es ist klar, dass diese Erfindung völlig willkürlich sein muss. Der Geist kann unmöglich jemals die Wirkung in der mutmaßlichen Ursache finden, nicht einmal durch die sorgfältigste Forschung und Untersuchung. Die Wirkung ist nämlich von der Ursache gänzlich verschieden und kann folglich niemals in ihr entdeckt werden. Die Bewegung der zweiten Billardkugel ist ein von der Bewegung der ersten völlig verschiedenes Ereignis, und in der einen ist nichts vorhanden, was den geringsten Hinweis auf die andere gäbe. […]
Können nicht beide Kugeln in absoluter Ruhe bleiben? Kann nicht die erste Kugel in gerader Linie zurückkehren oder von der zweiten in irgendeiner Linie oder Richtung wegspringen? Alle diese Annahmen sind […] vorstellbar. Weshalb also sollten wir einer den Vorzug geben, die nicht […] vorstellbarer ist als die übrigen? Alle unsere apriorischen Erörterungen werden nie imstande sein, uns einen Grund für diese Bevorzugung zu zeigen. […]
Was ist nun aus alledem die Schlussfolgerung? Eine ganz simple, obgleich – wie man zugeben muss – eine von den herkömmlichen philosophischen Theorien recht weit entfernte. Aller Glaube an Tatsachen oder wirkliche Existenz stammt lediglich von einem dem Gedächtnis oder den Sinnen gegenwärtigen Gegenstand und einer gewohnheitsmäßigen Verbindung zwischen diesem und irgendeinem anderen Gegenstand; oder, mit anderen Worten: Nachdem man gefunden hat, dass in vielen Fällen zwei Arten von Gegenständen – Feuer und Hitze, Schnee und Kälte – immer in Zusammenhang standen, wird der Geist, wenn Feuer oder Schnee sich erneut den Sinnen darbieten, aus Gewohnheit dazu gebracht, Hitze oder Kälte zu erwarten und zu glauben , dass es eine derartige Qualität gibt und sie sich nun bei eingehenderer Beschäftigung entdecken wird. Dieser Glaube ist das notwendige Resultat, wenn man den Geist in eine solche Lage bringt. Es ist ein seelischer Vorgang (operation of the soul) , der in dieser Lage ebenso unvermeidlich ist wie das Gefühl der Liebe, wenn wir Wohltaten empfangen, oder des Hasses, wenn uns Unrecht widerfährt.
Alle diese Vorgänge sind eine Art natürlicher Instinkte, die keine Vernunfttätigkeit, d. h. kein Denk- oder Verstandesprozess jemals hervorzubringen oder zu verhindern vermag.
ebd. S. 85-86, 43-44, 45, 66-67
Lernzettel
Theorieeinordnung:
- Schulbüchern zufolge war Hume ein Vertreter des Empirismus, wenngleich seine Theorie eher einer Synthese aus Verstand und Sinnen entspricht.
Problemfrage:
- Wie gewinnt der Mensch Erkenntnis? Gibt es sichere Erkenntnis?
Lösung:
- Erkenntnis entspringt den Sinnen; Wissen durch Erfahrung ist niemals sicher.
Argumentation:
- es gibt 2 Perzeptionen des Verstandes:
1. Eindrücke (impressions): originale Sinneswahrnehmungen → lebhaft, stark
2. Ideen (ideas): Nachbilder der Eindrücke → schwächer, weniger intensiv - Folge: Eindrücke sind für den Erkenntnisgewinn wichtiger, da sie die Realität widerspiegeln
- Ideen sind dennoch notwendig, um Zusammenhänge zu knüpfen und Urteile zu bilden
- Verknüpfung von Ideen durch 3 Prinzipien der Assoziation:
1. Ähnlichkeit: sich ähnelnde Ideen werden miteinander verknüpft
2. Berührung in Raum & Zeit: Ideen, die räumlich/zeitlich nah beieinander sind, werden verknüpft
3. Ursache & Wirkung: Ideen werden verknüpft, wenn die eine als Ursache der anderen (Wirkung) erkannt wird - Wie bildet der Mensch Urteile?
- Humes Fork (Weg vom Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More zum Urteil):
- Metallgriff: Eindrücke → daraus folgen Ideen
→ Weg vom Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More zur Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More: „Copy-These“ (die gesammelten Eindrücke werden „kopiert“ und daraus im Verstand neue Ideen geschaffen) - Zacken der Gabel:
1. analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile (relations of ideas): bloße Wahrheiten; notwendig und allgemein gültig (Bsp.: „drei mal fünf gleich die Hälfte von dreißig“) → Gegenteil nicht widerspruchsfrei denkbar
2. synthetische Urteile (matters of fact): Tatsachen; Gegenteil ist widerspruchsfrei denkbar - InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More: allgemeingültige Schlüsse & Schlüsse über zukünftige Ereignisse sind ungewiss → basieren auf Kausalitätsprinzip (s. Bsp. Billardkugel)
- Problem: Es ist niemals sicher, dass auf die gleiche Ursache immer die gleiche Wirkung folgt
→ Folge: Erfahrung kann kein sicheres Wissen liefern. - Fazit: Nach Hume gewinnt der Mensch Erkenntnis ausschließlich durch Sinneseindrücke (impressions) und deren Verknüpfung zu Ideen (ideas). Allein analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile bieten sichere Erkenntnis – synthetische Urteile bleiben unsicher, da sie auf subjektiver Erfahrung und induktiven Schlüssen beruhen.
Schaubild
Klausurtext
Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.
Viel Erfolg beim Lernen!
Der schottische Philosoph David Hume, der zumindest Schulbüchern zufolge Vertreter des Empirismus war, ging davon aus, dass alle Erkenntnis aus den Sinnen entspringt.
Hume zufolge bestehe ein deutlicher Unterschied zwischen den zwei Perzeptionen des Verstandes: den Eindrücken und den Ideen. Nach Hume handle es sich genau dann um Eindrücke, wenn sie originale Sinneswahrnehmungen, also äußere Wahrnehmungen seien. Sie [die Eindrücke] seien die lebhafteren Perzeptionen und somit stärker als Ideen. Um Ideen handle es sich nämlich genau dann, wenn sie Nachbilder der Eindrücke im Verstand seien, weshalb sie nur schwächer und weniger intensiv empfunden werden könnten.
Daraus schließt Hume, dass Eindrücke für die Erkenntnis wichtiger seien, da sie die Realität widerspiegeln würden, die Ideen aber trotzdem notwendig für den Erkenntnisgewinn seien, da durch den Verstand Zusammenhänge geknüpft und Urteile gebildet würden.
Und obwohl es so scheint, als sei das menschliche Denken unbegrenzt, weil der Verstand die Ideen beliebig zu neuen Dingen verknüpfen könne, sei dies nur möglich, weil vorher ein Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More gesammelt wurde, aus dem erst eine Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More entspringe. Beispielhaft führt er den Gedanken an einen goldenen Berg an, den der Mensch sich nur denken könne, weil ihm die Begriffe „Gold“ und „Berg“ aus der Erfahrung bekannt seien.
Verknüpfungen wie beispielhaft diese schaffe der Verstand mithilfe von drei verschiedenen Prinzipien der Assoziation: dem Prinzip der Ähnlichkeit, bei diesem sich ähnelnde Ideen miteinander verknüpft würden, dem Prinzip der Berührung in Raum und Zeit, durch welches Ideen, die räumlich bzw. zeitlich nah beieinander sind, verknüpft würden und dem Prinzip von Ursache und Wirkung, d.i. dem Kausalitätsprinzip, durch das der Verstand Ideen verbinde, wenn die eine als Ursache der anderen (Wirkung) erkannt werde.
Wie zuvor erwähnt würden die Ideen also benötigt, um Urteile zu bilden, wobei der Weg von einem Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More bis zu einem Urteil sinnbildlich durch Hume’s Fork – eine zweizackige Gabel – dargestellt wird. Der Metallgriff der zweizinkigen Gabel stellt die Eindrücke, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More alle Sinneswahrnehmungen dar, aus denen die Ideen folgen. Diesen Weg vom Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More zur Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More nennt Hume Copy-These.
Mithilfe von Eindrücken und Ideen, also durch den Verstand, könne der Mensch folglich Urteile bilden. Hume unterscheidet dabei zwischen analytischen Urteilen, welche die eine Gabelspitze darstellen und synthetischen Urteilen, die die andere Gabelspitze darstellen. Analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile würden bloße Wahrheiten darstellen und müssten notwendig und allgemein gültig sein, da ihr Gegenteil nicht widerspruchsfrei denkbar sei. So sei der mathematische Satz „drei mal fünf gleich die Hälfte von dreißig“ ein analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More, da er notwendig sei, sich sein Gegenteil also nicht widerspruchsfrei denken lasse, und er ohne Eindrücke möglich sei.
Synthetische Urteile hingegen stellen nach Hume Tatsachen dar, die über die Begriffe hinaus gehen würden, d.h. zusammengesetzt sind, und folglich nicht notwendig seien, da immer das Gegenteil denkbar und möglich sei, wie z.E. der Satz „Schwäne sind weiß“.
Weiterführend erläutert Hume das InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More, welches besagt, dass alle Schlüsse über zukünftige Geschehnisse oder Schlüsse, die auf Basis des Kausalitätsprinzips getroffen wurden, wie bspw. der Stoß einer Billardkugel und die darauffolgende Bewegung einer weiteren, niemals gewiss seien und folglich auch kein sicheres Wissen darstellen könnten, es mithin überhaupt kein sicheres Wissen geben könne, das von der Erfahrung abgeleitet sei.
(Anna-Marie H. – LK MH 2024)
Der Schottische Philosoph David Hume beschäftigte sich ebenso mit der Erkenntnistheorie. Laut Schulbüchern vertrat er eine empiristische Position zur Gewinnung von Erkenntnis, tatsächlich basiert seine Theorie aber eher auf dem Verarbeiten von Eindrücken mithilfe des Verstandes, weshalb seine Position auch rationalistische Züge aufweist.
Zunächst unterteilt Hume die Perzeptionen des Verstandes – äußere und innere Wahrnehmungen – in zwei Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More. Einerseits gebe es die Eindrücke (impressions), welche lebhafte Perzeptionen durch sinnliche Aufnahme seien, wie etwa sehen, fühlen oder schmecken. Andererseits gebe es die Ideen (ideas), die schwächere, weniger lebhafte Perzeptionen darstellen würden, da sie nur ein Abbild der Eindrücke im Verstand seien. Obwohl Hume den Eindrücken einen höheren Wert zuschreibt, da die Ideen von ihnen abhängig seien, gesteht er ein, dass beide dieser Perzeptionen notwendig sind, um Erkenntnis zu gewinnen.
Weiter postuliert er, es gebe drei Prinzipien der Assoziationen, durch die Ideen verknüpft würden.
Bei dem Prinzip der Ähnlichkeit würden bereits bekannte Eindrücke als Ideen auftreten und möglicherweise kombiniert. Diese gedankliche Kombination benennt Hume als ,,Copy-These“ und verdeutlicht sie mit dem Beispiel eines goldenen Berges, welchen es zwar nicht wirklich gebe, der jedoch durch die Kombination der bekannten Eindrücke ,,Gold“ und ,,Berg“ zu einer Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More im Verstand führe. Folglich sei der Mensch in seinem Denken auf das beschränkt, was er wahrnehme, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die Eindrücke.
Des Weiteren gebe es das Prinzip der Assoziation der Berührung in Raum und Zeit, durch welches Ideen, die räumlich bzw. zeitlich nah beieinander seien, miteinander verknüpft würden, wie z.B. das Verlassen eines Raumes und das Betreten eines anderen, sowie das Prinzip der Assoziation von Ursache und Wirkung – das Kausalitätsprinzip -, durch dieses Ideen verknüpft würden, wenn die eine Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More als Ursache der anderen (Wirkung) erkannt wird.
Zur Verdeutlichung seiner Behauptung über die Bildung von Urteilen erklärt Hume weiterführend das Sinnbild einer zweizinkigen Gabel – genannt „Hume’s fork“ – bestehend aus einem Griff, zwei Zinken und einem Verbindungsstück. Der Griff, also der Ursprung der Urteilsbildung, stelle die sinnlichen Eindrücke dar. Das Verbindungsstück zwischen dem Griff und den Zinken seien die Ideen, die, wie bereits erklärt, wegen der Copy-These verschiedenste Abbilder der Eindrücke kombinierten und dadurch Urteile bildeten.
Mit den Zinken der Gabel stellt Hume die beiden Urteilsarten dar: Einerseits gebe es analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile (relations of ideas), welche notwendig wahr seien, wie etwa mathematische Gleichungen, da ihr Gegenteil nicht widerspruchsfrei sei. Andererseits gebe es synthetische Urteile (matters of fact), bei denen es sich um Wahrheiten handele, deren Gegenteil sich widerspruchsfrei denken lasse, wie beispielsweise die Aussage ,,Schwäne sind Weiß“. Die Annahme ,,Schwäne sind Schwarz“ wäre auch nicht falsch, da die beiden Aussagen sich in keinem Widerspruch verfangen.
Ausführend erläutert Hume das InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More: Der Mensch treffe basierend auf bisher gesammelten Eindrücken Entscheidungen, ohne ein Wissen darüber zu haben, was passieren werde, in der Annahme, dass die gleiche Wirkung eintreten werde wie zuvor. Bei einem sogenannten ,,Black Swan Event“ geht der Mensch davon aus, die Wirkung einer Ursache aufgrund vorheriger ähnlicher Erfahrungen vorhersehen zu können, es geschehe jedoch etwas Unerwartetes.
Mit dem InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More wollte Hume zeigen, dass der Mensch lediglich in der Lage dazu sei, die Kausalität, also dass etwas passieren werde, zu bestimmen, nicht aber sicher die Wirkung der Ursache, da es sich um synthetische Urteile handle, bei denen Gegenteile widerspruchsfrei denkbar seien. Hume verdeutlicht dies durch das Beispiel eins Billardspiels, bei dem der Mensch zwar annehmen könne, dass etwas geschieht, wenn die Kugeln sich treffen, nicht aber, was genau geschehe, da selbst trotz physikalischer Berechnungen stets ein unvorhergesehener Windstoß oder Ähnliches die Wirkung verändern könne. Es sei dem Menschen also unmöglich, aus der Erfahrung sichere Erkenntnis zu gewinnen.
(Manuel R. – LK MH 2025)
Der schottische Philosoph David Hume stellte sich in seinem Werk die Ausgangsfrage, wodurch der Mensch Erkenntnis erlange.
In seiner Analyse des menschlichen Erkenntnisprozesses stellte er fest, alle Erkenntnis wurzele aus der Erfahrung, weshalb er sich, zumindest nach Schulbüchern, dem Empirismus zuordnen lässt. Diese auf dem Empirismus basierende Position ist jedoch viel mehr eine Synthese aus der Erfahrung und dem Verstand, wodurch sie eher zwischen Empirismus und Rationalismus eingeordnet werden müsste.
Humes Theorie liegen zwei Arten der Perzeption des Verstandes zugrunde, die er zunächst voneinander differenziert. Einerseits gebe es die Eindrücke (impressions), welche laut Hume originale Sinneswahrnehmungen seien, wodurch sie für den Menschen besonders stark und lebhaft seien. Andererseits gebe es die Ideen und Gedanken (ideas & thoughts), welche Nachbilder der Eindrücke im Verstand seien.
Den Verstand vergleicht Hume dabei mit einer Bühne, auf dieser die Eindrücke als Ideen immer wieder auftreten, d.h. nachempfunden, würden. Da die Ideen allerdings nur Kopien der Eindrücke darstellten, seien jene niemals so stark wie diese und deswegen nur schwächer und weniger intensiv zu empfinden. Daraus schließt er, die Eindrücke seien die wichtigere Perzeption, da nur diese die Realität widerspiegeln würden. Die Ideen verstand Hume dennoch als notwendig, der Verstand mithilfe vom Ideen Zusammenhänge knüpfe und Urteile bilde.
Dieser Vorgang des Verknüpfens von Ideen geschehe durch drei verschiedene Prinzipien der Assoziation: durch das Prinzip der Berührung in Raum und Zeit, das Prinzip der Ähnlichkeit sowie das Prinzip von Ursache und Wirkung, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More das Kausalitätsprinzip.
Die Bildung eines Urteils, also der Weg von einem Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More zu einem Urteil, wird auch als „Humes Fork“ bezeichnet. Diese sinnbildliche Vorstellung einer zweizackigen Gabel veranschaulicht die zwei möglichen Urteilstypen.
Zunächst stelle der Griff einen durch die äußere und innere Wahrnehmung gewonnenen Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More dar. Dieser Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More werde durch eine Assoziation erneut in den Verstand gerufen, er wird sozusagen „kopiert“. Daher wird dieser Vorgang – der Weg vom Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More zur Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More – auch als „Copy-These“ bezeichnet, welcher durch den Übergang zwischen Griff und Zacken dargestellt wird.
Schließlich würden sich daraus die Urteile bilden. Dabei stehe jede Zacke der Gabel für eine Urteilsart. Hume benennt alle Urteile, welche eine bloße, notwendige und allgemein gültige Wahrheiten darstellen, als analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More (relations of ideas). Die bloße Wahrheit „Drei mal fünf ist gleich die Hälfte von dreißig“ z.B. bezeichne ein solches Urteil, dessen Gegenteil nicht ohne Widerspruch denkbar sei und das nur dem Verstand entspringe.
Die andere Art würden die synthetischen Urteile bilden (matters of fact). Diese würden, so Hume, Tatsachen darstellen, deren Gegenteil sich widerspruchsfrei denken lasse. Beispielsweise kann die Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More eines goldenen Berges die Grundlage eines synthetischen Urteils bilden, etwa: „Der goldene Berg existiert.“ Der goldene Berg setzte sich aus den Eindrücken von „Gold“ und „Berg“ zusammen, welche zusammen auf der Bühne des Verstandes auftreten und verknüpft werden. Das Gegenteil, nämlich „Der goldene Berg existiert nicht.“ ist widerspruchsfrei denkbar und möglich. Folglich seien synthetische Urteile aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Erfahrung nicht notwendig.
Zuletzt erläutert Hume, dass Schlüsse über die Zukunft und allgemein gültige Aussagen, beruhend auf dem Kausalitätsprinzip, keine sichere Erkenntnis liefern könnten. Diese Beobachtung bezeichnet er als InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More. Solche induktiven Schlüsse würden auf gesammelten Erfahrungen basieren. Diese [Erfahrungen] wiederum bildeten die Grundlage synthetischer Urteile, liefern jedoch kein sicheres Wissen. Ein Beispiel dafür liefert Hume mit dem Billardspiel: Bei diesem gehe der Mensch davon aus, dass das Aneinanderstoßen von zwei Kugeln zur Folge, also die Wirkung, habe, dass sich die zweite Kugel bewege. Ein unvorhergesehenes Ereignis könne diese These jedoch, trotz vorheriger Berechnungen der Laufbahn der Kugel, widerlegen.
Aus dem InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More folgert Hume, dass jegliches Wissen auf der Basis von Erfahrungen niemals sicher ist und der Mensch lediglich analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile als sicher anerkennen kann.
(Jonas A. – LK MH 2025)
Tragfähigkeit
– es ist logisch, dass Eindrücke intensiver sind als Ideen, da jene originale Wahrnehmungen und diese nur Nachempfindungen sind (s. Bsp. goldener Berg)
– als Säugling hat man kaum Eindrücke und erlangt immer mehr Wissen durch die Wahrnehmung
– menschliches Wissen ist begrenzt → erst, wenn man einen Eindruckbei Hume: originale Sinneswahrnehmung durch die Sinnesorgane… More hat, kann man diesen im Verstand verknüpfen → „Erfahrung ist der Beginn aller Erkenntnis“ (s. Kant)
– das InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More ist logisch und an vielen Stellen zu beobachten (s. Schwäne, Strudel, Wissenschaft)
– Die Annahme, Gewohnheiten seien nicht dauerhaft konstant, ist nachzuvollziehen
– dass Eindrücke wichtiger seien als Ideen, ist falsch → Eindrücke und Ideen sind beide gleichermaßen notwendig, um Erkenntnis zu erlangen → „Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. […] Nur daraus, dass sie sich vereinigen kann Erkenntnis entspringen.“ (s. Kant)
– mathematische Urteile seien analytischlogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More und durch bloße Denktätigkeiten erschließbar → Fehlschluss → sie sind synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, weil sie zusammengesetzt sind (s. Kant)
– aus dem InduktionsproblemProblem, dass es keine logische Begründung dafür gibt, das… More schließt er, dass es kein sicheres Wissen gibt → Kants KritizismusName für Kants Position in der Erkenntnistheorie, die den E… More beweist, dass sicheres Wissen in Form von analytischen und synthetischen Urteilen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More möglich ist
Teste dein Wissen
Die zwei Perzeptionen des Verstandes sind die Eindrücke (impressions) und die Ideen (ideas).
Um einen Eindruck handelt es sich laut Hume genau dann, wenn etwas eine originale Sinneswahrnehmungen ist. Deshalb bezeichnet er Eindrücke auch als die lebhaften Perzeptionen.
Um Ideen handelt es sich genau dann, wenn sie Nachbilder der Eindrücke im Verstand sind, weshalb sie die schwächeren Perzeptionen sind.
Hume postuliert, dass alle Erkenntnis den Sinnen entspringt.
Da die Eindrücke für ihn die wichtigeren Perzeptionen sind, weil sie intensiver wahrgenommen werden als die Ideen und weil jedwede Erkenntnis auf Ihnen beruhe, haben Schulbücher ihn als Empiristen eingeordnet. Das stimmt aber nicht ganz, denn auch wenn die Eindrücke für ihn wichtiger sind, gibt er dennoch zu, dass auch der Verstand notwendig ist, um Erkenntnis zu gewinnen, bspw. um Urteile zu bilden.
Ideen sind laut Hume notwendig, um Zusammenhänge zu knüpfen und Urteile zu bilden, was an „Hume’s Fork“ deutlich wird.
Hume postuliert, der Mensch kann sich einen goldenen Berg denken, ohne jemals einen gesehen zu haben. Dazu sei es aber notwendig, vorher schonmal Eindrücke zu den Begriffen „golden“ und „Berg“ gesammelt zu haben, damit der Verstand diese zu Ideen verknüpfen kann.
Das menschliche Denken sei also insofern begrenzt, als dass es nur Urteile bilden und Ideen verknüpfen kann, wenn vorher passende Eindrücke gesammelt wurden, die Material für den Verstand bieten.
Der Begriff „Copy-These“ beschreibt den Weg von einem Eindruck zu einer Idee. Hume postuliert, dass aus den Eindrücken Nachbilder im Verstand – die Ideen – gebildet werden können, wenn man die gesammelten Eindrücke nachempfindet bzw. sich erneut in Erinnerung ruft. Dabei könne man auch mehrere Ideen kombinieren.
Hume’s Fork dient zur Veranschaulichung für den Prozess der Urteilsbildung, zeigt also den Weg vom Eindruck zum Urteil.
Der Metallgriff der zweizinkigen Gabel stellt die Eindrücke dar auf denen alles basiert, aus denen dann die Ideen, also der Metallteil, folgen. Der Weg vom Eindruck zur Idee heißt „Copy-These“.
Die zwei Zacken der Gabel stellen die analytischen und die synthetischen Urteile dar.
Hume unterscheidet zwischen analytischen und synthetischen Urteilen.
Um analytische Urteile handelt es sich nach Hume genau dann, wenn es bloße Wahrheiten sind. Diese seien notwendig und allgemein gültig wie bspw. der mathematische Satz 3 x 5 = 30:2
Die analytischen Urteilen sind ihm zufolge reine Verstandesurteile, deren Gegenteil sich nicht widerspruchsfrei denken lässt.
Um synthetische Urteile handelt es sich laut Hume genau dann, wenn sie Tatsachen sind, deren Gegenteil denkbar ist. Ein Beispiel, das Hume anbringt, wäre: „Schwäne sind weiß“.
Das Induktionsproblem besagt, dass alle Schlüsse über zukünftige Geschehnisse, wie bspw. der Stoß einer Billardkugel und die darauffolgende Bewegung einer weiteren, niemals gewiss sind und folglich auch kein sicheres Wissen darstellen können, es mithin überhaupt kein sicheres Wissen gibt, das von der Erfahrung abgeleitet ist.
Dies begründet Hume damit, dass auch Schlüsse auf Basis des Kausalitätsprinzips nur durch vorherige Beobachtung getroffen wurden, d.h. eine Vorhersage sind, die Wirkung jedoch auch eine andere sein kann. So könnte es bspw. sein, dass die errechnete Bewegung der angestoßenen Billardkugel nicht eintritt, weil ein Windstoß, eine Unebenheit oder ein anderer Faktor die Bahn der Kugel verändert.
Hume unterscheidet nur zwischen analytischen und synthetischen Urteilen, wobei nur die analytischen Urteile unanfechtbare Erkenntnis darstellen würden.
Kant reicht diese Unterteilung nicht aus und er unterscheidet noch zwischen Erkenntnissen a priori und a posteriori.
Laut Kant bilden analytische und synthetische Urteile a priori sichere Erkenntnis.
Als analytische Urteile definiert er solche, bei denen Subjekt und Prädikat auseinander hervorgehen. Sein Beispiel dafür ist „Körper sind ausgedehnt“.
Synthetische Urteile definiert er als solche, bei denen Subjekt und Prädikat NICHT auseinander hervorgehen. Dazu zählen ihm zufolge alle Urteile der Mathematik und Logik.
Synthetische Urteile a priori sind Verstandesurteile, die unser Wissen erweitern, jedoch zusammengesetzt sind. Hier führt er 7+5=12 als Beispiel an.
Deshalb kritisierte Kant auch Humes Urteilsarten, da er mathematische Urteile wie 7+5=12 den analytischen zuordnete, diese aber nicht in diese Kategorie passen, da sie zusammengesetzt sind.
Mathematische Urteile sind laut Kant deshalb synthetisch a priori, da sie zwar allgemein gültig jedoch zusammengesetzt sind: Aus 5+7 muss notwendigerweise 12 folgen; aus der 12 müssen aber nicht nur 5+7 hervorgehen.
Lernmaterial
Wichtig: Hume wird in Schulbüchern zwar immer dem Empirismus zugeordnet, an seiner Position wird aber schnell deutlich, dass er die Erfahrung als Quelle der Erkenntnis ansieht, der Verstand jedoch auch essentiell ist, um bspw. Ideen, also nachempfundene Sinneseindrücke, auftreten zu lassen. Er legte vielmehr den Grundbaustein für Kants Theorie, die besagt, dass Erkenntnis nur durch eine Synthese von Erfahrung und Verstand möglich ist.
Einen guten Überblick zu Humes Erkenntnistheorie bildet das folgende Video:
David Hume – Erkenntnistheorie