Hermeneutik
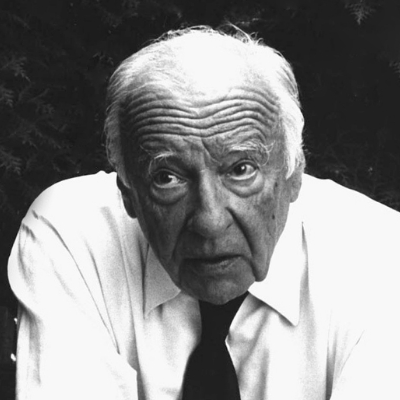
Hans-Georg Gadamer
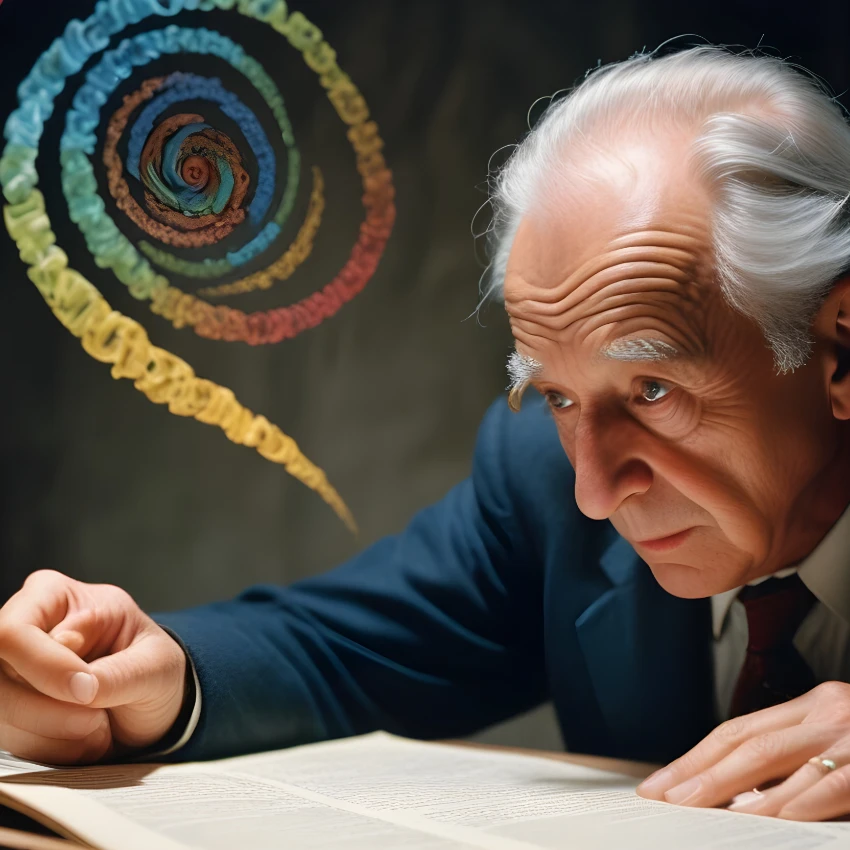
Inhalt
Biografie
Zitate
Original Textauszug
Verstehen als hermeneutische Grundhaltung:
Wer einen Text verstehen will, vollzieht immer ein Entwerfen. Er wirft sich einen Sinn des Ganzen voraus, sobald sich ein erster Sinn im Text zeigt. Ein solcher zeigt sich wiederum nur, weil man den Text schon mit gewissen Erwartungen auf einen bestimmten Sinn hin liest. Im Ausarbeiten eines solchen Vorentwurfs, der freilich beständig von dem her revidiert wird, was sich bei weiterem Eindringen in den Sinn ergibt, besteht das Verstehen dessen, was dasteht. […]
Wer zu verstehen sucht, ist der Beirrung durch Vor-Meinungen ausgesetzt, die sich nicht an den Sachen selbst bewähren. Die Ausarbeitung der rechten, sachangemessenen Entwürfe, die als Entwürfe Vorwegnahmen sind, die sich „an den Sachen“ erst bestätigen sollen, ist die ständige Aufgabe des Verstehens. […]
Jedem Text gegenüber ist die Aufgabe gestellt, den eigenen Sprachgebrauch […] nicht einfach ungeprüft einzusetzen. Wir erkennen vielmehr die Aufgabe an, aus dem Sprachgebrauch der Zeit bzw. des Autors unser Verständnis des Textes erst zu gewinnen. […]
Man wird sagen müssen, dass es im Allgemeinen erst die Erfahrung des Anstoßes ist, den wir an einem Text nehmen – sei es, dass er keinen Sinn ergibt, sei es, dass sein Sinn mit unserer Erwartung unvereinbar ist –, die uns einhalten und auf das mögliche Anderssein des Sprachgebrauchs achten lässt. […]
Gewiss kann es keine generelle Voraussetzung sein, dass das, was uns in einem Text gesagt wird, sich meinen eigenen Meinungen und Erwartungen bruchlos einfügt. Was mir einer sagt, ob im Gespräch, Brief oder Buch oder wie immer, steht ja zunächst im Gegenteil unter der Voraussetzung, dass es seine und nicht meine Meinung ist, die da ausgesprochen wird und die ich zur Kenntnis zu nehmen habe, ohne dass ich dieselbe zu teilen brauche. Aber diese Voraussetzung ist nicht eine erleichternde Bedingung für das Verstehen, sondern insofern eine Erschwerung, als die mein Verständnis bestimmenden eigenen Vormeinungen ganz unbemerkt zu bleiben vermögen. […]
Sieht man näher zu, so erkennt man jedoch, dass auch Meinungen nicht beliebig verstanden werden können. So wenig wir einen Sprachgebrauch dauernd verkennen können, ohne dass der Sinn des Ganzen gestört wird, so wenig können wir an unserer eigenen Vormeinung über die Sache blindlings festhalten, wenn wir die Meinung eines anderen verstehen. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man jemanden anhört, oder an eine Lektüre geht, alle Vormeinungen über den Inhalt und alle eigenen Meinungen vergessen müsste. Lediglich Offenheit für die Meinung des anderen oder des Textes wird gefordert. Solche Offenheit aber schließt immer schon ein, dass man die andere Meinung zu dem Ganzen der eigenen Meinung in ein Verhältnis setzt oder sich zu ihr. Nun sind zwar Meinungen eine bewegliche Vielfalt von Möglichkeiten […], aber innerhalb dieser Vielfalt des Meinbaren, d. h. dessen, was ein Leser sinnvoll finden und insofern erwarten kann, ist doch nicht alles möglich, und wer an dem vorbeihört, was der andere wirklich sagt, wird das Missverstandene am Ende auch der eigenen vielfältigen Sinnerwartungen nicht einordnen können. […]
Wer verstehen will, wird sich von vornherein nicht der Zufälligkeit der eigenen Vormeinung überlassen dürfen, um an der Meinung des Textes so konsequent und hartnäckig wie möglich vorbeizuhören – bis etwa diese unüberhörbar wird und das vermeintliche Verständnis umstößt. Wer einen Text verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen- Daher muss ein hermeneutisch geschultes Bewusstsein für die Andersheit des Textes von vornherein empfänglich sein. Solche Empfänglichkeit setzt aber weder sachliche „Neutralität“ noch gar Selbstauslöschung voraus, sondern schließt die abhebende Aneignung der eigenen Vormeinungen und Vorurteile ein. Es gilt, der eigenen Voreingenommenheit inne zu sein, damit sich der Text selbst in seiner Andersheit darstellt und damit in die Möglichkeit kommt, seine sachliche Wahrheit gegen die eigene Vormeinung auszuspielen.
Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Mohr, Tübingen 1960. S. 271-274
Verstehen als Horizontverschmelzung:
[…] Zum Begriff der Situation gehört daher wesenhaft der Begriff des Horizontes . Horizont ist der Gesichtskreis, der all das umfasst und umschließt, was von einem Punkt aus sichtbar ist. […] Umgekehrt heißt „Horizont haben“, nicht auf das Nächste eingeschränkt sein, sondern über es hinaussehen können. Wer Horizont hat, weiß die Bedeutung aller Dinge innerhalb dieses Horizontes richtig einzuschätzen nach Nähe und Ferne, Größe und Kleinheit. […]
Freilich reden wir im Bereich des historischen Verstehens auch gern von Horizont […].
Die Aufgabe des historischen Verstehens schließt die Forderung ein, jeweils den historischen Horizont zu gewinnen, damit sich das, was man verstehen will, in seinen wahren Maßen darstellt. Wer es unterlässt, derart sich in den historischen Horizont zu versetzen, aus dem die Überlieferung spricht, wird die Bedeutung der Überlieferungsinhalte missverstehen. Insofern scheint es eine berechtigte hermeneutische Forderung, dass man sich in den andern versetzen muss, um ihn zu verstehen.
Es ist genauso wie im Gespräch, das wir mit jemandem nur zu dem Zwecke führen, um ihn kennenzulernen, d. h. um seinen Standort und seinen Horizont zu ermessen. Das ist kein wahres Gespräch, d. h. es wird darin nicht die Verständigung über eine Sache gesucht, sondern alle sachlichen Inhalte des Gespräches sind nur ein Mittel, um den Horizont des anderen kennenzulernen. Man denke etwa an das Prüfungsgespräch oder bestimmte Formen der ärztlichen Gesprächsführung. Das historische Bewusstsein tut offenbar Ähnliches, wenn es sich in die Situation der Vergangenheit versetzt und dadurch den richtigen historischen Horizont zu haben beansprucht.
So wie im Gespräch der andere, nachdem man seinen Standort und Horizont ermittelt hat, in seinen Meinungen verständlich wird, ohne dass man sich deshalb mit ihm zu verstehen braucht, so wird für den, der historisch denkt, die Überlieferung in ihrem Sinn verständlich, ohne dass man sich doch mit ihr und in ihr versteht.
[Ferner muss] man […] immer schon Horizont haben, um sich dergestalt in eine Situation versetzen zu können. Denn was heißt Sichversetzen? Gewiss nicht einfach: Von-sich-absehen.
Natürlich bedarf es dessen insoweit, als man die andere Situation sich wirklich vor Augen stellen muss. Aber in diese andere Situation muss man sich selber gerade mitbringen. Das erst erfüllt den Sinn des Sichversetzens. Versetzt man sich z. B. in die Lage eines anderen Menschen, dann wird man ihn verstehen, d. h. sich der Andersheit, ja der unauflöslichen Individualität des Anderen gerade dadurch bewusst werden, dass man sich in seine Lage versetzt. […]
Ein wahrhaft historisches Bewusstsein sieht die eigene Gegenwart immer mit, und zwar so, dass es sich selbst wie das geschichtliche Andere in den richtigen Verhältnissen sieht. […]
In Wahrheit ist der Horizont der Gegenwart in steter Bildung begriffen, sofern wir alle unsere Vorurteile ständig erproben müssen. Zu solcher Erprobung gehört nicht zuletzt die Begegnung mit der Vergangenheit und das Verstehen der Überlieferung, aus der wir kommen. Der Horizont der Gegenwart bildet sich also gar nicht ohne die Vergangenheit. Vielmehr ist Verstehen immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender Horizonte.
ebd., S. 307-312
Lernzettel
Theorieeinordnung:
- Mit seiner HermeneutikLehre des Verstehens More stellt Gadamer keine Methodenlehre auf, sondern klärt die Regeln und Bedingungen des Verstehens
Problemfrage:
- Wie gelangt man zum Verstehen?
Lösung:
- Verstehen ist ein Prozess der Verknüpfung des eigenen Horizonts mit dem fremden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More.
Argumentation:
- Grundannahme: Mensch wirft dem Text immer einen Sinn voraus (Erwartungen, Vor-Urteile) → er hat schon vor dem ersten Lesen eine Erwartung an den Text, die durch das Lesen geprüft werden muss
- Wer verstehen will, ist also Vor-urteilen ausgesetzt → Gadamer meint aber nicht negativ konnotierte Vorurteile, sondern lediglich Vormeinungen, die mit der Lektüre des Textes geprüft werden müssen
- Vor-Urteile (Vormeinungen) sind notwendige Voraussetzung des Verstehens
- → ABER: Offenheit für den Text und Zurückhaltung der eigenen Meinung sind ebenso notwendig
- Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More = Gesamtheit aller relevanten Erfahrungen, allen Wissens und aller Vor-Urteile einer Person
- Verstehen des historischen Horizontes durch Annäherung & idealerweise HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More
- HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More = Bildung eines großen, beweglichen Horizontes durch die Verbindung des eigenen Horizonts mit dem fremden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More (Text)
- dazu: Annäherung an die Perspektive des fremden Horizontes → Bewusstwerden der Andersheit
- auf dem Weg des Verstehens müssen Barrieren wie z.E. Sprache, Wortschatz, Epoche überwunden werden →Warum? – um den Text verstehen bzw. sich dem historischen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More annähern zu können
- folglich muss ein historisches Bewusstsein vorhanden sein, um Vergangenes verstehen zu können
- HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More als Ideal(!) → die Verschmelzung beider Horizonte ist nicht möglich, da die Bedeutung und der Sinn eines historischen Textes niemals vollständig erfasst werden können → daher müssen wir uns mit einer bestmöglichen Annäherung begnügen
- Folge der Annäherung: kontinuierliche Weiterentwicklung & Vergrößerung des eigenen Horizonts
- Veranschaulichung des Verstehensprozesses: Hermeneutischer Zirkel
→ zirkelförmiger Prozess des Verstehens (V → T → V1 → T1 → V2 → T2 → …)
→ wechselseitige Beeinflussung von Vor-Urteilen und Überlieferung - Fazit: Nach Gadamer gelangt man zum Verstehen, indem man sich seiner eigenen Vor-Urteile bewusst ist und sie im Dialog mit dem Text kritisch prüft, um sich an den fremden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More anzunähern. Dieser hermeneutische Prozess erfordert Offenheit für die Andersheit des Textes sowie die Bereitschaft, den eigenen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More durch die Auseinandersetzung stetig zu erweitern.
Schaubild
Klausurtext
Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.
Viel Erfolg beim Lernen!
Der deutsche Philosoph Hans-Georg Gadamer veröffentlichte seine erkenntnistheoretische Position zur HermeneutikLehre des Verstehens More in seinem Werk „Wahrheit und Methode“, mit der er keine Methodenlehre, sondern die Regeln und Bedingungen des Verstehens aufstellte. Seine hermeneutische Theorie entfaltete er vor dem Hintergrund der Frage wie man zum Verstehen (von Texten) gelangt.
Zu Beginn erklärt er, um zu verstehen, versuche der Mensch durch einzelne Teile ein Ganzes zu entwerfen, wobei die sogenannten Vor-Urteile eine fundamentale Rolle spielen würden. Als Vor-Urteilbei Gadamer: Vormeinung bzw. Vorwissen zu einem Thema More bezeichnet Gadamer eine eigene Vor-Meinung, die man von einem Medium bzw. Text habe, welche eine notwendige Voraussetzung für das Verstehen eines Textes darstelle. Da diese Vor-Urteile aber nur „Vorwegnahmen“, quasi Vermutungen, seien, müssten diese im Prozess des Verstehens erst geprüft und gegebenenfalls angepasst oder revidiert werden.
Im diesem Prozess des Verstehens treffe der Mensch allerdings auf bestehende Barrieren, wie zum Exempel die Sprache der Zeit bzw. des Autors, die es zunächst zu überwinden und anzunehmen notwendig sei. Um einen Text also zu verstehen, betont er weiterführend, sei es nicht notwendig, die eigenen Vormeinungen zu vergessen oder die Meinung des Autors anzunehmen, jedoch eine Offenheit für den Text mitzubringen und die eigenen Vormeinungen zurückzustellen, sich ihrer aber dennoch bewusst zu sein, da sie für das Verstehen notwendig seien.
Beschränke man sich nämlich nur auf die eigene Perspektive, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die eigenen Vor-Urteile, werde ein wirkliches, richtiges Verstehen jeglichen Textes unmöglich. Ein historisches Bewusstsein für die Andersheit von Texten müsse der Verstehende immer bereits besitzen, um sich seiner eigenen Voreingenommenheit bewusst zu werden und sich der Perspektive des fremden Horizontes (Text) bestmöglich annähern zu können. Unter Andersheit versteht Gadamer jene Differenz, die zwischen dem eigenen gegenwärtigen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More und dem historischen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More des Textes besteht.
Gadamer äußert überdies einen weiteren für das Verstehen wesentlichen Begriff – den Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More. Nach ihm ist etwas genau dann ein Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, wenn er das alles umfassende Blickfeld von einem Punkt ausgehend, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die Gesamtheit aller Vor-Meinungen, Vorverständnisse und Erfahrungen eines Menschen, ist. Besitzt man diesen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, so sei man in der Lage, alle Dinge innerhalb dieses Horizontes zu verstehen.
Wer nun einen historischen, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More einen fremden, in der Vergangenheit entstanden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, verstehen will, der müsse sich diesem annähern, sodass eine HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More erst möglich werde. Hierzu führt Gadamer als Beispiel das Gespräch an, in dem wir den Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More einer anderen Person kennenlernen, mithin wir ihre Meinung verstehen, wenn wir ihr offen begegnen und sie zulassen, ohne sie jedoch akzeptieren zu müssen. Ähnlich sei es mit dem eigenen historischen Bewusstsein, das sich versuche, in die Vergangenheit zu versetzen, um den richtigen historischen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More anzunehmen.
In Gadamers Augen bedeutet ,,Sichversetzen“ allerdings nicht, sich von seinem subjektiven Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More zu lösen oder von ihm abzusehen, denn dieser sei sogar essenziell für das Verstehen des historischen Horizontes, da nur so die Andersheit zu dem historischen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More in den richtigen Verhältnissen erkannt und ein wirkliches historisches Bewusstsein erreicht werden könne.
Um schlussendlich zum Verstehen zu gelangen, müsse man sich diesem fremden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More annähern und versuchen, seine Perspektive einzunehmen, d.h. die eigenen Vor-Urteile mit dem Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More des Textes zu verbinden. Verstehen ist laut Gadamer schlussendlich ein Vorgang der Verschmelzung sich überlappender und beeinflussender Horizonte im Inneren bzw. in der nicht-distanzierbaren hermeneutischen Situation, wobei sich der eigene, gegenwärtige Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More immer weiterbilde und verändere, in jedem Moment, in dem er sich mit einem fremden, historischen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More verbinde.
Diese Verschmelzung stellt allerdings ein unerreichbares Ideal dar, da der ursprüngliche Sinn des Textes nie vollständig erfasst werden kann – insbesondere bei historischen Texten. Nur dem Autor des Textes selbst ist es vorbehalten, seinen Sinn und seine Bedeutung vollständig zu begreifen.
Diesen Prozess der Verstehens, der aus vielen Schritten besteht, veranschaulicht Gadamer mithilfe des hermeneutischen Zirkels, bei dem zunächst ein Vorverständnis, bestehend aus dem eigenen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More und den Vor-Urteilen, vorhanden sei, welches man mit dem ersten Textverständnis prüfe, folglich erweitere, und so weiter. Je öfter ich einen Text also lese, desto mehr erschließt sich mir seine Bedeutung und sein Sinn, da ich mein Vorverständnis um ein neues Textverständnis und dieses wiederum und ein neues Vorverständnis erweitere.
(Anna-Marie H. – LK MH 2024)
Hans Georg Gadamer war ein deutscher Philosoph des 20. Jahrhunderts und ist durch seine Erkenntnistheorie und insbesondere seine HermeneutikLehre des Verstehens More bekannt. Er stellte sich die grundlegende Frage, wie der Mensch zu Verständnis von Texten und anderen Sinneszusammenhängen in menschlichen Lebensäußerungen aller Art gelangen könnte. Hierbei interessierte ihn besonders, welche Rolle vorgefasste Meinungen (Vor-Urteile) und Erfahrungen für das Verstehen von Sinnzusammenhängen spielen. Mit Hinblick auf diese Fragen stellte er eine hermeneutische Theorie auf.
Um Verständnis zu erlangen, sei es nach Gadamer wichtig, zunächst einzelne Teile zu verstehen, damit sich daraus das Ganze erschließe. Das Ganze wiederum ermögliche anschließend auch wieder Rückschlüsse über die einzelnen Teile. Ein nicht von dem Autor angebrachtes, veranschaulichendes Beispiel wäre, dass einzelne Musiknoten ein ganzes Musikstück ergeben.
Laut Gadamer sei eine notwendige Voraussetzung für das Verstehen das Vor-Urteilbei Gadamer: Vormeinung bzw. Vorwissen zu einem Thema More. Hierbei entspreche das Vor-Urteilbei Gadamer: Vormeinung bzw. Vorwissen zu einem Thema More einer Vor-Meinung. Etwas sei genau dann ein Vor-Urteilbei Gadamer: Vormeinung bzw. Vorwissen zu einem Thema More, wenn es Erfahrungen und verschiedenen Perspektiven eines Individuums enthalte. Diese seien demnach nicht negativ konnotiert und immer auf einen Sachzusammenhang bezogen.
Gadamer postuliert überdies, dass man jedem Text bzw. Medium mit einer offenen Haltung begegnen und davon ausgehen solle, dass dieser für einen verständlich wäre. Diese Offenheit gegenüber einem Text erlaube dem Menschen, den Inhalt des Textes zu verstehen und seinen eigenen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More zu erweitern. Etwas sei genau dann ein Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, wenn er die Gesamtheit der Erfahrungen und Vor-Urteile eines Individuums umfasse, die unabhängig von dem Text oder der Ausdrucksform seien.
Aus dem hermeneutische Prozess, den Gadamer beschreibt, resultiere dann die Verschmelzung des eigenen Horizontes mit dem fremden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More des Textes. Diesen Prozess bezeichnet Gadamer als HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More. Jedoch wichtig zu verstehen ist, dass Gadamer die HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More als Ideal versteht, da die vollständige Bedeutung eines Textes nie vollständig erfasst werden könne.
Gadamer betont weiterhin, dass das Verstehen eines Textes ein kontinuierlicher Annäherungsprozess sei. In diesem Prozess überwinde der Mensch seine Vorurteile allmählich und nähere sich dem Verständnis des Textes immer mehr an.
Der historische Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More spiele bei der Interpretation von Ausdrucksformen wie zum Beispiel bei alten Texten ebenfalls eine große Rolle. Der Mensch müssen sich bewusst machen, wie sich beispielsweise die Zeit und die Sprache auf den Kontext des Textes und seine Bedeutung auswirken würde. Dabei ist es entscheidend, dass der Lesende die Andersheit des Textes erkennt – also dessen Fremdheit in Sprache, Zeit oder Denkweise – und sich ihr offen nähert. Diese Barrieren müssen laut Gadamer überwunden werden, um ein tieferes Verständnis zu erlangen.
Nach dem Verstehen eines Textes schlussendlich durchlaufe der Mensch ein Prozess der Reflexion, indem er sein neu erlangtes Wissen mit dem dem bereits bestehenden Wissen seines eigenen Horizontes vergleiche und auf diese Weise nicht nur Verständnis gewinnt, sondern auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen Denkens ermöglicht.
Den Prozess des hermeneutischen Verstehens visualisiert Gadamer mit dem hermeneutischen Zirkel. Dieser besagt, man solle mit seinem eigenen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, bestehend aus Vorverständnis, Vor-Urteilen und relevanten Erfahrungen, und einer offenen Haltung gegenüber dem Text starten. Nach dem ersten Lesen des Textes gewinne man ein erstes Textverständnis, um dieses man sein Vorverständnis erweitere, mit dem man den Inhalt interpretieren könne. Durch diese Interpretation gewinne man ein neues Textverständnis, welches das ursprüngliche Vorverständnis wieder erweitere und verändere. Durch das immer erweiterte Vorverständnis, das durch die Auseinandersetzung mit dem Text entstehe, vertiefe man das Verständnis des Textes zunehmend.
(Ravza K. – LK MH 2024)
Der deutsche Philosoph Hans-Georg Gadamer beschäftigte sich in seinem Werk Wahrheit und Methode umfassend mit der Frage, wie wir zum Verstehen von Texten und Sinnzusammenhängen gelangen können. Mit seiner HermeneutikLehre des Verstehens More liefert er keine systematische Methodenlehre, sondern klärt die Grundbedingungen des menschlichen Verstehens.
Gadamer postuliert, dass der Mensch versuche, aus einzelnen Teilen ein Ganzes zu entwerfen. Beispielhaft anzubringen wäre hier ein Text, der nur mit den einzelnen Wörtern Sinn ergibt bzw. aus diesen entsteht. Um den ganzen Text jedoch verstehen zu können, bracht man die einzelnen Wörter.
Außerdem definiert er das Vor-Urteilbei Gadamer: Vormeinung bzw. Vorwissen zu einem Thema More oder auch die Vormeinung, mit der man zum Beispiel an einen Text herangehe. Diese sei eine notwendige Voraussetzung zum Verstehen des Sachverhaltes und nicht wie das gängige Vorurteil negativ, sondern positiv konnotiert. Vor-Urteile seien wichtig für das Verständnis und nur dadurch könne der eigene Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, den Gadamer als die Gesamtheit der Vorkenntnisse und Erfahrungen, also die Summe der persönlichen Erfahrungen und des Wissens, definiert, erweitert werden. Die mitgebrachten Vor-Urteile seien wichtig für das Verstehen des Textes, jedoch sei es ebenfalls sehr wichtig, dem Text offen zu begegnen und ihn verstehen zu wollen. Nur so könne man den Text vollends erschließen. Man versetze sich hierbei in einen anderen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More hinein, aber verlasse seinen eigenen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More nicht.
Außerdem gebe es den historischen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, welcher in der Vergangenheit entstanden sei und es deshalb möglicherweise mehr Barrieren zu überwinden gebe. Hierbei sei vor allem der zeitliche Unterschied bemerkbar: Beispielsweise stammt ein Text von Gadamer nicht aus der heutigen Zeit und man braucht gewisse Hintergrundkenntnisse sowie Fähigkeiten, um sich in den Autor hineinzuversetzen und seinen Text zu verstehen. Diese Differenzen verdeutlichen die Andersheit des historischen Horizonts, die es bewusst wahrzunehmen und ernst zu nehmen gilt.
Im Vergleich dazu gehe jede Person anders an einen Text heran, da jeder andere Vor-Urteile und somit einen anderen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More habe. Die beiden Horizonte könnten dementsprechend nie identisch sein, da sie nur verschmelzen und nicht eins würden. Außerdem beinhalte der eigene Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More alles, was man subjektiv wahrnehme und erfahre, weshalb es für jeden anders sei.
Um die HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More zu erreichen, solle man sich dem fremden Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More annähern und möglichst gleiche Voraussetzungen haben, also z.B. auf der sprachlichen Ebene den Text lesen können. Dabei solle man die eigenen Vor-Urteile nicht vergessen, aber dem Text möglichst offen gegenübertreten.
Ein ideales Verstehen erfolge durch die sogenannte HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More, wozu zunächst die Barrieren überwunden werden müssen, um eine richtige Interpretation zu garantieren. Gadamer betont jedoch, dass eine völlige HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More nicht erreichbar, sondern nur ein Ideal ist, da sich der Sinn eines fremden Textes niemals vollständig erfassen lasse.
Zur praktischen Anwendung hat Hans-Georg Gadamer den hermeneutischen Zirkel erstellt, eine Methode zum Verstehen von Texten. Man gehe mit einem gewissen Vorverständnis an einen Text heran. Dieses bilde sich aus dem eigenen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More, den situationsspezifischen Vor-Urteilen und der HorizontverschmelzungVersuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse eines anderen Indi… More. Durch das Lesen eines Textes komme man zum Vorverständnis 1, bei dem man seine Vor-Urteile mit dem Gelesenen verknüpfe und das bestehende Wissen erweitere. Nun lese man den Text erneut und verbinde immer mehr neu erworbenes Wissen aus dem Text mit dem bestehenden Vorwissen. Am Ende überprüfe man erneut die Vor-Urteile und habe folglich einen erweiterten Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More.
Ziel dieses Prozesses ist nicht nur ein besseres Textverständnis, sondern die kontinuierliche Erweiterung und Bildung des eigenen Horizonts.
(Selina H. – LK MH 2024)
Tragfähigkeit
- Theorie ist in alltäglichen Situationen nachvollziehbar und anwendbar
→ Barrieren sind in Situation des Verstehens immer vorhanden
→ das Verstehen wird schwieriger je nachdem aus welchem Kontext bzw. welcher Zeit der Text stammt - die Erweiterung des eigenen Horizontes durch die Verschmelzung ist sinnvoll
- bildet eine nützliche Anleitung, vor allem, wenn es um das Zusammenleben in der Gesellschaft geht → hilft dem Menschen, seine Vorurteile beiseite zustellen und mehr Verständnis aufzubringen
- Weg des Verstehens beschränkt sich nicht nur auf Texte, sondern ist auf nahezu jeden Sachverhalt anwendbar
- der eigene Horizont werde durch äußere subjektiv wahrnehmbare Faktoren beeinflusst (Staat, Bezugsperson, Gesellschaft) → nachvollziehbar, denn wir machen den Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More anderer Person abhängig von der sozialen Situation eines Menschen → Vorurteile
- Die meisten scheinbar negativen Punkte weisen eher auf ein Problem des Menschen im Verstehens Prozess hin und sind keine Schwächen seiner Position
- man erweitere seinen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More mit jeder Verschmelzung, d.h. der hermeneutische Zirkel geht nur von einer Erweiterung des Vorverständnisses aus
→ Teile des eigenen Horizontes können aber durch Unfälle, Alkohol, Drogen, etc. verloren gehen → geht nicht darauf ein - Wie entwickelt sich das erste Vorverständnis, wenn man noch keinen Horizontgeistiger Bereich, den jemand überblickt; subjektives Blick… More besitzt? → Babys haben noch kein Vorverständnis und können nicht verstehen → „tabula rasa“
Teste dein Wissen
Gadamer stellt Regeln und Bedingungen des Verstehens auf und betont, dass das Verstehen nicht durch eine spezifische Methode, sondern durch das Zusammenspiel von Vor-Urteilen und der Offenheit für den Text erfolgt.
Laut Gadamer handelt es sich genau dann um Vor-Urteile, wenn es eigene Vor-Meinungen sind, die man von einem Medium oder Text hat und die eine notwendige Voraussetzung für das Verstehen darstellen.
Diese Vor-Meinungen seien Vorwegnahmen oder Vermutungen, die nach dem Verstehen geprüft werden müssten.
Mögliche Barrieren, die im Verstehensprozess überwunden und angenommen werden müssen seien z.B. die Sprache der Zeit und des Autors, die Epoche oder Werte und Normen der Zeit.
Gadamer betont die Notwendigkeit, Offenheit für den Text zu haben, die eigenen Vormeinungen zurückzustellen, ohne sie jedoch zu vergessen oder die Meinung des Autors annehmen zu müssen.
Wenn man sich nur auf die eigene Perspektive beschränkt, wird ein wirkliches, richtiges Verstehen eines Textes unmöglich.
Etwas sei genau dann ein Horizont, wenn es das alles umfassende Blickfeld von einem Punkt ausgehend ist, d.i. die Gesamtheit aller Vor-Meinungen, Vorverständnisse und Erfahrungen, die es ermöglichen, alle Dinge innerhalb dieses Horizontes zu verstehen.
Horizontverschmelzung ist der Prozess, bei dem der eigene Horizont mit einem fremden, historischen Horizont verbunden wird, indem man sich dem fremden Horizont annähert und versucht, seine Perspektive einzunehmen.
Der eigene subjektive Horizont ist essenziell für das Verstehen des historischen Horizonts, da er hilft, die Andersheit des historischen Horizonts in den richtigen Verhältnissen zu erkennen und ein wirkliches historisches Bewusstsein zu erreichen.
Der hermeneutische Zirkel veranschaulicht, dass der Verstehensprozess ein Kreislauf ist, der mit einem Vorverständnis, bestehend aus dem eigenen Horizont und den Vor-Urteilen, beginnt, das durch das erste Textverständnis geprüft und ständig angepasst wird, um ein tieferes Verständnis des Textes zu erreichen.

Das Endziel des Verstehensprozesses ist die Erweiterung des eigenen subjektiven Horizontes durch eine Verschmelzung des eigenen Horizontes mit dem fremden.
Dies werde erreicht, indem man die eigenen Vor-Urteile und Erfahrungen mit dem Horizont des Textes verbindet und so den eigenen Horizont ständig weiterbilde und verändere.