Kritizismus
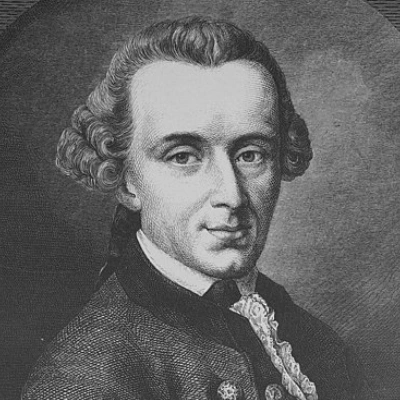
Immanuel Kant

Inhalt
Biografie
Zitate
Original Textauszug
Die kopernikanische Wende der Philosophie:
[D]ie Vernunft [sieht] nur das ein […], was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt, dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten […].
[…]
Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll.
Es ist hiermit ebenso als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.
In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. […]
Immanuel Kant: Werke in zehn Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Bd. 3: Kritik der reinen Vernunft, Sonderausgabe. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983. S. 23-27
Erkenntnis und Erfahrung:
Dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und […] teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt. Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alle an.
Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.
Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benötigte […] Frage: ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe.
Man nennt solche Erkenntnisse a priori, und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung, haben. […]
Erfahrung lehrt uns zwar, dass etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, dass es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urteil a priori. […] Wird also ein Urteil in strenger Allgemeinheit gedacht, d. i. so, dass gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori, und gehören auch unzertrennlich zu einander.
ebd., S. 45-47
Analytische und synthetische Urteile:
In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird […], ist dieses Verhältnis auf zweierlei Art möglich.
Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem andern synthetisch. […] Die erstere könnte man auch Erläuterungs-, die andere Erweiterungsurteile heißen, weil jene durch das Prädikat nichts zum Begriff des Subjekts hinzutun, […] da hingegen die letztere zu dem Begriffe des Subjekts ein Prädikat hinzutun, welches in jenem gar nicht gedacht war […].
Z.B. wenn ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein analytisch[es] Urteil. Denn ich darf [brauche] nicht über den Begriff, den ich mit dem Körper verbinde, hinausgehen, um die Ausdehnung, als mit demselben verknüpft, zu finden, sondern jenen Begriff nur zergliedern […].
Dagegen, wenn ich sage: alle Körper sind schwer, so ist das Prädikat etwas ganz anderes, als das, was ich in dem bloßen Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzufügung eines solchen Prädikats gibt also ein synthetisch[es] Urteil. Erfahrungsurteile, als solche, sind insgesamt synthetisch […].
Aber bei synthetischen Urteilen a priori fehlt dieses Hilfsmittel ganz und gar. […] Man nehme den Satz: Alles, was geschieht, hat seine Ursache. In dem Begriff von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht etc., und daraus lassen sich analytische Urteile ziehen. Aber der Begriff einer Ursache liegt ganz außer jenem Begriffe, […] ist also in dieser letzteren Vorstellung gar nicht mit enthalten.
ebd., S. 52-55
Raum und Zeit:
Vermittelst des äußeren Sinnes (einer Eigenschaft unsres Gemüts) stellen wir uns Gegenstände als außer uns, und diese insgesamt im Raume vor. […]
Alles, was zu den innern Bestimmungen gehört, [wird] in Verhältnissen der Zeit vorgestellt. Äußerlich kann die Zeit nicht angeschaut werden, so wenig wie der Raum. […]
Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen worden. […] Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, dass kein Raum sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden. Er wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen […] angesehen, und ist eine Vorstellung a priori, die notwendigerweise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt. […]
Die Zeit ist kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge. […] Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbsten nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben.
ebd., S. 71, 72, 78
Anschauung und Begriff:
Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des Gemüts) gedacht. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unsrer Erkenntnis aus, so dass weder Begriffe, ohne ihnen auf einige Art korrespondierende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe, ein Erkenntnis abgeben können. […]
Unsre Natur bringt es so mit sich, dass die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d. i. nur die Art enthält, wie wir von Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. […]
Beide Vermögen, oder Fähigkeiten, können auch ihre Funktionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, dass sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen. […]
ebd., S. 97-98
Lernzettel
Theorieeinordnung:
- In seinem erkenntnistheoretischen Werk Kritik der reinen Vernunft untersucht Kant die Grenzen und Möglichkeiten der reinen Vernunft, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der Vernunft unabhängig von aller Erfahrung. Da Kant seine eigene Vernunft einer kritischen Prüfung unterzieht, wird seine Theorie auch als KritizismusName für Kants Position in der Erkenntnistheorie, die den E… More bezeichnet
Problemfrage:
- Was kann ich wissen? Gibt es sichere Erkenntnis?
Lösung:
- Erkenntnis entspringt aus der Synthese von Anschauung und Begriff. Sicheres Wissen ist in Form von analytischen und synthetischen Urteilen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More möglich.
Argumentation:
- Aufbau der Kritik der reinen Vernunft
1. Transzendentale ÄsthetikKants Untersuchung der Sinnlichkeit (s. Kritik der reinen Ve… More (Lehre der Sinnlichkeit) → Raum & Zeit a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More
2. Transzendentale LogikKants Untersuchung des Denkens (s. Kritik der reinen Vernunf… More (Lehre des Denkens)
2.1 Transzendentale AnalytikKants Untersuchung des Verstandes (s. Kritik der reinen Vern… More (Prüfung des Verstandes) → Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More & transzendentales Schema
2.2. Transzendentale DialektikKants Untersuchung der Vernunft (s. Kritik der reinen Vernun… More (Prüfung der Vernunft) → Ideen & Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More der reinen Vernunft
- 1. Beobachtung: „Erfahrung ist der Beginn aller Erkenntnis“
2. Beobachtung: zwei Quellen der Erkenntnis: Synthese aus Sinnen und Verstand (Anschauungen & Begriffe) → „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (Bsp. Kniga & Kugelschreiber)
3. Beobachtung: Verstand ist zentrales Maß aller Dinge → Gegenstände richten sich nach dem Verstand (s. Kopernikanische Wende nach Kant)
→ mithilfe der Synthese aus Sinnen & Verstand kann der Mensch Urteile bilden - Urteilsarten:
→ a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More = Eigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig sind und mit der Vernunft gefällt werden
→ a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More = Eigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefällt werden
→ analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More & synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More = sicheres Wissen, da sie notwendig und allgemein gültig sind
→ synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More gilt es zu suchen, da sie, anders als analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile, unser Wissen erweitern- analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More: Subjekt & Prädikat gehen auseinander hervor
- synthetisches Urteilbei Kant: erfahrungsabhängiges, zusammengesetztes Urteil; S… More: Subjekt & Prädikat gehen nicht auseinanderhervor
- synthetisches Urteilbei Kant: erfahrungsabhängiges, zusammengesetztes Urteil; S… More a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More: nicht notwendig & nicht allgemeingültig → machen 99,9% unserer alltäglichen Aussagen aus<
- synthetisches Urteil a prioriein Urteil, das nicht auf Erfahrung, sondern auf logischen V… More: notwendig & allgemeingültig; fügen dem Begriff neue Informationen hinzu
- Beispiele:
- analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More: „Körper sind ausgedehnt.“ / „Ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann.“
- synthetisches Urteil a prioriein Urteil, das nicht auf Erfahrung, sondern auf logischen V… More: „5+7=12“ → aus 5+7 geht die 12 hervor, aus der 12 gehen aber nicht 5+7 hervor / „Cogito ergo sum“
- synthetisches Urteilbei Kant: erfahrungsabhängiges, zusammengesetztes Urteil; S… More a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More: „Schwäne sind weiß.“
- analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More: ein solches Urteil aufzustellen, ergibt keinen Sinn
- Dinge an sich & Erscheinungen:
- Ding an sich: Teil des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More; darüber kann der Mensch nichts wissen
- Ding als Erscheinung: Teil des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More; Gegenstände, wie wir sie wahrnehmen → der Mensch kann nur die Erscheinungen der Dinge wahrnehmen (Bsp. Saturn)
- Was sind die Bedingungen der Erkenntnis?
- Bedingungen für die sinnliche Erkenntnis (transz. Ästhetik) sind Raum & Zeit als apriorische Begriffe → Vorstellungen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, die allen Anschauungen zugrunde liegen
- Bedingungen für die Erkenntnis durch den Verstand (transz. Analytik) sind die Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More (= apriorische Verstandesbegriffe) & das transzendentale Schema → ordnen alles Material der Sinne
→ Bsp. Kategorie der Kausalität: Der Kaffee ist kalt, weil er schon so lange rumsteht. → Die kausale Verbindung selbst lässt sich nicht wahrnehmen, sie wird jedoch immer schon mitgedacht.
→ transzendentales Schema (Bsp. Hund): Wir erkennen in der Zeichnung eines spezifischen Hundes das Wesen eines Hundes allgemein, ohne also auf eine Rasse beschränkt zu sein
- Grenzen menschlicher Erkenntnis – Kapitel „die Insel im Meer“:
,,Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen.“ → Wir können außer der Welt der Erscheinungen nichts sicher wissen.- Insel: Welt der Dinge als Erscheinungen (Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More) →Erkenntnis erfolgt durch Synthese aus Sinnen & Verstand
- Ozean: Welt der Dinge an sich (Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More) →Vermutungen über die Welt der Dinge an sich kann nur die Vernunft aufstellen
- Transzendentale Ideen:
- Unsterblichkeit (Mensch)
- Freiheit (Welt)
- Gott
→ Vernunft äußert Urteile, die über die Erfahrung hinausgehen
→ diese Urteile führen zu Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More (auch: „Widerstreit der Gesetze“)
- Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More der reinen Vernunft
- mathematische Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More:
1. Raum & Zeit
2. Materie
→ Thesis und Antithesis schließen sich aus, können also nicht zusammen existieren.
→ Kant löst die falsche Annahme auf, dass Raum und Zeit Dinge an sich seien, denn sie haben nur in unserem Verstand Realität. - dynamische Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More:
3. Freiheit & Kausalität in der Natur
4. Gott
→ die Thesen beziehen sich auf die Welt der Dinge an sich
→ die Antithesen beziehen sich auf die Welt der Erscheinungen
→ Thesis und Antithesis der dynamischen Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More können als Gegensätze zusammen existieren; sie müssen beide stattfinden können. - Bsp.: Wenn ich einen Ertrinkenden aus dem Wasser ziehe, gibt es 2 mögliche Gründe:
1. Kausalität, weil ich als Rettungsschwimmer dafür bezahlt werde (Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More)
2. Freiheit, weil ich sittlich motiviert bin, ihm das Leben zu retten (Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More)
- mathematische Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More:
- Fazit: Kants zeigt in der KrV, dass Erkenntnis durch die Synthese von sinnlicher Anschauung (Raum und Zeit als apriorische Formen) und Verstandeskategorien (wie Kausalität) entsteht. Doch die Vernunft stößt an Grenzen, sobald sie über die Erfahrung hinausgeht (Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More). Damit ist objektiv gültiges Wissen nur im Bereich der möglichen Erfahrung möglich, während metaphysische Fragen (Gott, Freiheit, Unsterblichkeit) der spekulativen Vernunft überlassen bleiben. Sicheres Wissen liegt in synthetischen Urteilen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More (z. B. mathematische Wahrheiten), da sie notwendig und allgemeingültig sind. Die Dinge an sich bleiben jedoch unerkennbar, da sie jenseits unserer Erfahrungsstrukturen liegen. Aus der Tatsache, dass Freiheit in unserem Handeln möglich ist, kann Kant sein Moralgesetz, also den Beweis der Möglichkeit sittlichen Handelns, ableiten.
das unten in mehrere Teile aufgeteilte Schaubild findest du hier als vollständige PDF
Schaubild 2
Schaubild
Klausurtext
Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.
Viel Erfolg beim Lernen!
Das Werk „Kritik der reinen Vernunft“ von dem deutschen Philosophen Immanuel Kant ist ein zentraler Text der modernen Philosophie, der die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis und der Metaphysik untersucht. Das Werk, erstmals 1781 veröffentlicht, hat das Ziel, die Grenzen und Möglichkeiten der reinen Vernunft zu bestimmen, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der Vernunft unabhängig von aller Erfahrung.
Somit liegt Kants Kritik der reinen Vernunft die Kernfrage „Was kann ich wissen?“ zugrunde und beschäftigt sich zentral mit der Frage, wie Erkenntnis möglich ist.
Er beginnt seine Untersuchung mit der Feststellung, dass Erkenntnis nur durch ein Zusammenspiel von Erfahrung und Verstand möglich ist und widerlegt damit zugleich den Rationalismus und den Empirismus. Dazu hält er fest: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ Er erkannte also, dass der Mensch die Erfahrung benötigt, um Material zum Denken zu sammeln und den Verstand, um dieses Material zu ordnen und mit Begriffen zu füllen.
Diese Erkenntnis führt ihn zu einer revolutionären, neuen Betrachtungsweise des menschlichen Verstandes, die er die „kopernikanische Wende“ nennt. Er untersucht, wie die Objekte, die wir wahrnehmen, in Beziehung zu unserem Verstand stehen. Daraus resultierend benennt er den Verstand als das „zentrale Maß aller Dinge“, behauptet also, dass die Objekte unserer Wahrnehmung sich nach unserem Verstand richten und nicht der sich Verstand nach den Objekten. So seien Raum und Zeit reine Formen der Anschauung, die unsere Wahrnehmung strukturieren.
Nachdem er die Quellen der Erkenntnis bestimmt und das Verhältnis von Verstand und Gegenständen festgelegt hat, stellt er verschiedene Urteilsarten auf und prüft, welche Urteile sicheres Wissen darstellen.
Dazu unterscheidet er zunächst zwischen Erkenntnissen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More und a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More. Um a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More Erkenntnisse handelt es sich nach Kant genau dann, wenn sie unabhängig von Erfahrung sind und allgemein und notwendig gelten, wie etwa die Mathematik. A posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More Erkenntnisse hingegen sind Kant zufolge alle Erkenntnisse, die auf Erfahrung beruhen und daher spezifisch und nicht notwendig sind.
Ebenso unterscheidet er zwischen synthetischen und analytischen Urteilen. Analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile seien solche, in denen das Prädikat im Subjekt enthalten ist. Ein Beispiel, das Kant selbst anführt, ist „Körper sind ausgedehnt“. Die Eigenschaft ausgedehnt zu sein, ist bereits im Begriff des Körpers enthalten. Synthetische Urteile hingegen seien solche, in denen Subjekt und Prädikat nicht zusammenfallen. Diese Urteile seien zusammengesetzt und würden dem Subjekt neue Informationen hinzufügen, beispielsweise „Der Apfel ist rot“.
Aus seiner Prüfung der verschiedenen Urteilsarten zieht er letztendlich den Schluss, dass analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More und synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More dem Menschen sichere Erkenntnisse liefern, da sie unabhängig von Erfahrung und allgemeingültig seien.
Aus diesen Urteilsarten hebt Kant die synthetischen Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More besonders hervor, da synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More zwar zusammengesetzt seien, sie das menschliche Wissen aber, anders als die analytischen Urteile, erweitern würden. Dies sei der Fall, weil sie unabhängig von Erfahrungen und dennoch zusammengesetzt seien. Als Beispiel für synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More führt er den mathematischen Satz „5+7=12“ an.
Um die Grenzen menschlichen Wissens ausfindig zu machen, analysiert Kant weiterführend die Welt des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More und die Welt des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More. Die Welt des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More sei die Welt der Erfahrung, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die Welt, wie sie dem Menschen erscheint, geordnet durch Raum und Zeit und die Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More des Verstandes.
Die Welt des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More, welche die Welt des Verstandes und der Dinge an sich ist, bleibe uns prinzipiell unzugänglich.
Unsere Erkenntnis sei nämlich auf die Welt des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More beschränkt; die noumenalen Dinge könnten wir nur denken, nicht erkennen.
Diese Tatsache erläutert Kant mithilfe des Saturns: Was wir von dem Saturn erkennen, ist seine Erscheinung, die von unserem subjektiven Erkenntnisvermögen abhängig ist. Die Beschaffenheit des Saturns als Ding an sich, also unabhängig von unserer Erfahrung, aber bleibt uns gänzlich unbekannt, da er als Ding an sich zur Welt des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More gehört.
Dabei hält er fest, dass unsere Erkenntnisse immer auf den reinen Formen Raum und Zeit und den Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More basieren.
Mithilfe der Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More als den reinen Verstandesbegriffen, welche dem Verstand a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More zugrunde liegen würden, könne der Mensch seine Urteile sinnvoll ordnen. So könne er sich z.E. mithilfe der Kategorie der Kausalität denken, dass der Kaffee kalt geworden ist, weil er so lange rumgestanden hat, wahrnehmen könne er diese Kausalität jedoch nicht.
Im Hinblick auf die Schlussfolgerung, der Mensch könne über die Welt des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More nichts wissen, widmet er sich zuletzt den Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More der reinen Vernunft, welche zeigen, dass reine Vernunft ohne Bezug auf Erfahrung zu Widersprüchen führe. So könne die Vernunft z.E. sowohl beweisen, dass die Welt einen Anfang in der Zeit hat, als auch, dass sie keinen Anfang hat. Hier entstehe ein Widerspruch, weil der Mensch für beide Thesen gute Gründe finde, beide Ereignisse aber nicht nebeneinander bestehen könnten, denn es sei unmöglich, dass der Raum und die Zeit zugleich endlich und unendlich sind. Solche Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More zeigen laut Kant die Grenzen der reinen Vernunft und damit menschlicher Erkenntnis und die Notwendigkeit, sie durch die Kritik zu zügeln.
Die Thesis und Antithesis der Antinomie der Freiheit und Kausalität in der Natur hingegen ständen in keinem Widerspruch zueinander, denn Kant postuliert, dass die Kausalität der Natur zur Welt des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More gehöre, die Freiheit jedoch Bestandteil der Welt des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der gedachten Welt durch die Vernunft, sei. Diese Behauptung illustriert er anhand des Beispiels eines Rettungsschwimmers: Wenn ich einen Ertrinkenden aus dem Wasser ziehe, gibt es zwei mögliche Gründe für mein Handeln: Entweder handle ich aus Kausalität, weil ich als Rettungsschwimmer dafür bezahlt werde oder ich handle aus Freiheit, weil ich sittlich motiviert bin, dem Ertrinkenden das Leben zu retten. Daraus folgt laut Kant, dass sich beide Handlungsgründe nicht widersprechen, denn sie existieren in verschiedenen Welten.
Letztendlich wurde es Kant nur mithilfe dieser Feststellung, dass es Freiheit in menschlichem Handeln gibt, möglich, sein Moralgesetz aufzustellen und damit einen Beweis für die Möglichkeit sittlichen Handelns – durch die Freiheit – zu liefern.
Zusammengefasst untersucht Kants Kritik der reinen Vernunft die Bedingungen und Grenzen menschlicher Erkenntnis. Durch seine Analyse der Strukturen der Vernunft und ihre Anwendung auf die Erfahrung zeigt Kant, dass die menschliche Erkenntnis beschränkt ist auf die Welt des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More und belegt gleichzeitig, dass absolut sichere Erkenntnis durch synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More möglich ist.
(Anna-Marie H. – LK MH 2024)
Der deutsche Philosoph Immanuel Kant beschäftigt sich in seinem Hauptwerk „Kritik der reinen Vernunft“ mit der Problemfrage, wie wir Erkenntnisse erlangen. Seine Position hierzu nennt sich der KritizismusName für Kants Position in der Erkenntnistheorie, die den E… More. Seine Methode für die Beantwortung der Problemfrage besteht darin, die Optionen und Bedingungen für die Erkenntnisgewinnung zu prüfen.
Zunächst widerlegt Kant mit der sogenannten Kopernikanischen Wende – eine Anspielung auf Nikolaus Kopernikus’ Beleg für das heliozentrische Weltbild – die Annahme, dass der Verstand sich um den Gegenstand drehe bzw. sich nach diesem richte. Da wir Gegenstände nämlich immer nur so wahrnehmen könnten, wie es unsere Sinne erlauben und es ohne diese Sinne keine Erkenntnis über Gegenstände gebe, entspreche diese Tatsache eher der Vorstellung eines Gegenstandes, der sich um den Verstand drehe, sich also an unseren Verstand anpasse.
Einen so interpretierten Gegenstand bezeichnet Kant als „Ding als Erscheinung„. Den Gegenstand und seine Beschaffenheit unabhängig aller Erfahrung bezeichnet er als das „Ding an sich„.
Erkenntnisse über unsere Außenwelt, erläutert Kant, können jedoch nicht ausschließlich durch die Sinne bzw. die Wahrnehmung erfolgen – vielmehr sei ein Zusammenspiel aus Sinnen und Verstand notwendig. Diesen Gedanken legt er in dem Zitat „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ dar. „Gedanken ohne Inhalt sind leer“ ist hier so zu verstehen, dass der Verstand ohne Erfahrungen durch die Sinne nicht arbeiten könne – deshalb bezeichnet Kant Erfahrungen auch als den Beginn aller Erkenntnis. Die Aussage „Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ wiederum soll aussagen, dass wir allein durch die Sinne bzw. Erfahrung ebenfalls keine Erkenntnis gewinnen könnten, da es uns nicht möglich wäre, die gesammelten Wahrnehmungen zu interpretieren und zu betiteln, denn dies sei die Aufgabe des Verstandes.
Somit beginne zwar all unsere Erkenntnis mit der Erfahrung, doch dies, relativiert Kant, bedeute nicht, dass sie [Erkenntnis] auch notwendig aus der Erfahrung entspringe. Es gebe nämlich auch von der Erfahrung unabhängiges Wissen, das er als Erkenntnis a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More benennt.
Infolge dieser Beobachtung musste er jedoch feststellen, dass es sich bei den meisten Erkenntnissen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More um sogenannte analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile wie „Alle Körper sind ausgedehnt.“ handle, bei denen Subjekt und Prädikat auseinander hervorgehen. Deshalb seien sie nicht relevant für den Erkenntnisgewinn, denn derartige Begriffserklärungen seien zwar sichere, aber keine neue Erkenntnis.
Man müsse im Rahmen der Erkenntnistheorie also stattdessen nach notwendigen und zusammengesetzten, den sogenannten synthetischen Urteilen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, suchen. Die meisten synthetischen Urteile seien zwar aposteriorisch, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More von der Erfahrung abhängig, doch Kant gelang es unter anderem in der Mathematik, synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More zu finden. Dies begründet er damit, dass beispielsweise aus dem Ergebnis „12“ die Rechnung „5+7“ nicht notwendig hervorgehe, wohlFreude More aber die „12“ aus der Addition „5+7“.
Nachdem Kant also bewiesen hat, dass synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, mithin sichere und zugleich neue Erkenntnis möglich sei, untersucht er erweiternd, wie die Urteilsfindung in erster Linie erfolge. Hierfür teilt Kant den Umfang möglicher Erkenntnis in zwei Oberkategorien auf: Das für den Menschen Begreifbare, welches er als Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More bezeichnet und das für den Menschen nicht völlig Begreifbare – das Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More.
Zu dem Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More zählen, so Kant, alle Erkenntnisse, die wir durch die Sinne und den Verstand gewinnen können. Diese beiden Optionen für die Erkenntnisgewinnung untersucht Kant separat jeweils in der transzendentalen Ästhetik und der transzendentalen Analytik.
In der transzendentalen Ästhetik kommt der Philosoph so zu dem Schluss, dass die Sinne die reinen Formen Raum und Zeit a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More voraussetzen und erschließt dadurch neben mathematischen Aussagen zwei weitere synthetische Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, nämlich, dass alles, was existiere, irgendwo im Raum bzw. in der Zeit sein müsse.
Über den in der transzendentalen Analytik untersuchten Verstand erschließt er, dass dieser mithilfe sogenannter Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More und dem transzendentaler Schema arbeite. Hierbei führen die Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More dazu, dass wir alles mit den Sinnen Aufgenommene automatisch in Zusammenhänge setzen. Solche Zusammenhänge bestehen z.B. in kausalen Ketten oder in den Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More der Einheit, Vielheit und Allheit, also quantitativen Aussagen. Beispiele für letztere lassen sich etwa in den Schlüssen „Eine Katze ist verschwunden,“ „Mehrere Katzen sind verschwunden“ und „Alle Katzen sind verschwunden“ finden.
Das transzendentale Schema, welches eine weitere Ordnungsentität unseres Verstand bilde, sorge wiederum dafür, dass wir einen Gegenstand trotz Abweichung von einem anderen als zu derselben Art von Gegenstand zugehörig erkennen können. Zum Beispiel könnte jemand, der in seinem Leben noch nie zuvor eine andere Hunderasse als den Dackel gesehen hat, auch einen Husky als Hund erkennen.
Kant stellte jedoch fest, dass das Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More, da es für den Menschen nicht völlig begreifbare Konzepte wie die Unendlichkeit, Gott, Freiheit oder Ethik beinhaltet, über unseren Verstand und unser Erkenntnisvermögen hinausgehe.
(Jana Q. – LK MH 2025)
In dem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ untersucht der Philosoph Immanuel Kant die grundlegende Frage Was kann ich wissen? Dabei untersucht er zunächst das Verhältnis zwischen Sinneswahrnehmungen und Verstand und kommt zu dem Schluss, dass unser Wissen und unsere Wahrnehmung nicht durch unsere Außenwelt bestimmt werden, sondern von den Strukturen des Denkens abhängen. Diese erkenntniskritische Haltung nennt Kant selbst KritizismusName für Kants Position in der Erkenntnistheorie, die den E… More und grenzt sich damit sowohl vom Empirismus als auch vom Rationalismus ab.
Kants erste Beobachtung lautet „Erfahrung ist der Beginn aller Erkenntnis“, was in anderen Worten bedeutet, dass wir die Außenwelt immer zuerst mit unseren Sinnen wahrnehmen. Jedoch gebe es laut Kant zwei Quellen der Erkenntnis, nämlich neben den Sinnen auch noch den Verstand, die beide in einer Synthese verknüpft seien. Dieses Verhältnis erklärt er in anderen Worten auch noch mit “Anschauungen“ und „Begriffen“. Die Beziehung der beiden stellt er mithilfe folgenden Zitates dar: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“; dazu führt Kant ein Beispiel an: Man solle sich etwas unter dem Begriff „kniga“ vorstellen. Jeder Mensch, der diesen Begriff hört und die russische Sprache nicht beherrscht, kann sich unter dem Wort nichts vorstellen. Dies beweise nach Kant, dass unser Verstand alleine nicht reicht, um Erkenntnis zu gewinnen, da allein durch den Begriff kein Bild im Verstand entstehe. Andersherum wäre es einem Menschen aus dem 18. Jahrhundert (z.B. Kant), der zum ersten Mal einen Kugelschreiber sieht, ebenso unmöglich, dem Kugelschreiber einen Begriff im Verstand zuzuordnen; er hätte bloß eine „blinde Anschauung“, könne also durch bloße Wahrnehmung, genauso wenig Wissen erlangen.
In seiner 3. Beobachtung postuliert Kant den Verstand als das „zentrale Maß aller Dinge“. Damit meint er, dass sich alle Gegenstände der Wahrnehmung nach unserem Verstand richten und nicht unser Verstand sich nach den Gegenständen. Als Beispiel führt Kant den Saturn an, den man durch ein Teleskop betrachten kann. Beim Betrachten des Saturns sehe man nur seine Erscheinung und niemals den Saturn wie er an sich, unabhängig der Erfahrung, beschaffen ist. Denn das Ding an sich sei Teil des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More, worüber der Mensch kein Wissen verfüge. Das Ding als Erscheinung wiederum sei Teil des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More, d.i. die Welt der Wahrnehmung des Menschen und der Erfahrung.
Diese Synthese, durch die der Mensch Erkenntnis gewinne, ermögliche es ihm auch, Urteile zu bilden. Kant unterscheidet systematisch 4 Urteilsarten:
Einmal gebe es das synthetische Urteil a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, welches die für den Menschen bedeutendste Urteilsart ist, da Urteile dieser Art durch ihre zusammengesetzte Natur nicht nur notwendig und allgemeingültig seien, sondern darüber hinaus auch unseren Verstand um neues Wissen erweitern würden. Ein Beispiel für ein synthetisches Urteil a prioriein Urteil, das nicht auf Erfahrung, sondern auf logischen V… More, das Kant selbst anbringt, ist der mathematische Satz „5+7=12“: Da aus der Addition von 5 und 7 notwendigerweise die 12 hervorgeht, aber aus der 12 nicht die 5+7, da auch 6+6 die 12 ergeben, erweitert dieser Satz unser Wissen.
Zum anderen gebe es noch das synthetische Urteil a posteriori, welches nicht notwendig und nicht allgemeingültig sei. Diese Art Urteil umfasst nahezu alle unserer Alltagsaussagen. Ein Beispiel hierfür ist „Der Schwan ist weiß“, denn aus dem Begriff „Schwan“ geht nicht notwendigerweise der Begriff „weiß“ hervor, da es auch schwarze Schwäne gibt (Black Swan Event).
Analytischelogisch; verstandesgemäß; aus dem Verstand hervorgehend More Urteile a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More sind laut Kant alle Urteile, bei denen Subjekt und Prädikat auseinander hervorgehen. Solche Urteile seien zwar notwendig, da sie eine Art Begriffsbestimmung sind, würden unseren Verstand jedoch nicht um neues Wissen erweitern, da sie ihm keine Informationen hinzufügen. Der Satz „Ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann“ ist eines von Kants Beispielen für ein analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More.
Theoretisch ist auch die Bildung analytischer Urteile a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More möglich, diese in der Praxis aufzustellen, ergibt allerdings keinen Sinn, da die Bedeutung von a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More „vor der Erfahrung“ ist und ein analytisches Urteilnach Kant: ein notwendiges, allgemeingültiges Urteil, bei d… More a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More, das durch die Erfahrung nochmal geprüft würde, genau genommen immer noch a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More wäre, da es schon vor der Erfahrung und nicht erst durch die Erfahrung Geltung hat.
Wie bereits erwähnt, erlangen wir durch eine Synthese aus Sinnen und Verstand unser Wissen. Da unsere Erfahrung jedoch Zufälle enthält, untersuchte Kant die Sinnlichkeit auf Formen, die unsere Wahrnehmungen strukturieren. Diese Prüfung der Sinne betitelt Kant als transzendentale ÄsthetikKants Untersuchung der Sinnlichkeit (s. Kritik der reinen Ve… More.
„In der transzendentalen Ästhetik zeigt Kant, dass Raum und Zeit nicht aus der Erfahrung stammen, sondern dem menschlichen Erkenntnisvermögen als a priorische Anschauungsformen vorausliegen. Sie seien die Bedingungen der Erfahrung, da wir ohne sie nichts wahrnehmen könnten. Alles, was wir wahrnehmen, erfassen wir nach Kant immer innerhalb des Raumes und der Zeit. Der Raum sei die Struktur für äußere Wahrnehmungen (alles was außerhalb von uns ist, existiert im Raum) und die Zeit die Struktur für innere Wahrnehmungen (z.B. Erinnerungen).
Neben der Sinnlichkeit prüft Kant auch das Denken und also einerseits den Verstand, was er als transzendentale AnalytikKants Untersuchung des Verstandes (s. Kritik der reinen Vern… More nennt. Kant postuliert, dem Verstand liegen zwei fundamentale Ordnungsentitäten zugrunde – einerseits die Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More als apriorische Verstandesbegriffe und andererseits das transzendentale Schema. Beide Vermögen hätten die Funktion, durch unseren Verstand unsere Wahrnehmungen sinnvoll einzuordnen. Beispielsweise erkennt der Verstand bei dem Anblick eines Huskys, dass es sich um genau um einen Husky handele und ordne diese Feststellung in die Kategorie der „Einheit“ ein. Das transzendentale Schema wiederum ermöglicht es uns, die Wahrnehmung des Huskys und weitere ähnlicher Wahrnehmungen, also von Hunden, in einen Oberbegriff einzusortieren, ohne auf eine gewisse Rasse beschränkt zu sein.
Im letzten Schritt untersucht Kant noch Grenzen und Möglichkeiten Vernunft, was er als transzendentale DialektikKants Untersuchung der Vernunft (s. Kritik der reinen Vernun… More betitelt. Hier führt er die Analogie mit einer Insel und einem Meer an, in der die Insel das Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More und das Meer das Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More darstellt. Sinnbildlich ist unsere Vernunft ein verzweifelter Seefahrer, der dazu verurteilt sei, zu versuchen, aufs stürmische Meer zu fahren. Dabei kommen wir laut Kant nicht weiter, da die Fragen unserer Vernunft über das Unbedingte und Absolute unser Erkenntnisvermögen überschreiten.
Begibt der Mensch sich aber doch auf die Suche nach Antworten zu diesen Fragen, verfange er sich in Widersprüchen, die Kant als „Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More“ bezeichnet. Ein Beispiel für eine Antinomie ist die Frage, ob Raum und Zeit endlich oder unendlich sind. Der Widerspruch ergebe sich daraus, dass der Mensch für beide Thesen gute Gründe auflisten könne, beides aber nicht gleichzeitig bestehen kann. Es ist unmöglich, dass Raum und Zeit gleichzeitig endlich und unendlich sind. Daraus folgert Kant, dass wir diese Fragen nicht beantworten können, da Sie unser Erkenntnisvermögen überschreiten.
Anders hingegen verhalte es sich mit der Antinomie der Freiheit und Kausalität in der Natur. Kant löst den vermeintlichen Widerspruch auf, indem er postuliert, die Kausalität in der Natur sei Bestandteil des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More, die Freiheit aber sei Teil des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More, also der gedachten Welt. Zur Verdeutlichung führt er das Beispiel eines Rettungsschwimmers an: Wenn ich jemanden rette, der am Ertrinken ist, gibt es zwei mögliche Gründe: Entweder handle ich aus Kausalität, weil ich als Rettungsschwimmer dafür bezahlt werde oder ich handle aus Freiheit, weil ich sittlich motiviert bin, dem Ertrinkenden das Leben zu retten. Beide Gründe widersprechen sich also nicht, weil sie in zwei verschiedenen „Welten“ existieren.
Diese Unterscheidung zwischen empirisch-kausaler Erklärung und intelligibler Freiheit bildet die Voraussetzung für Kants praktische Philosophie. Wenn der Mensch als freies Wesen gedacht werden kann, ist sittliches Handeln möglich. Nur unter dieser Bedingung kann Kant später in der Kritik der praktischen Vernunft sein Moralgesetz begründen.
(Valentino M. – LK MH 2025)
Tragfähigkeit
- Kopernikanische Wende: Kant verlagert den Fokus von der Erkenntnis des Objekts auf die Bedingungen im Subjekt → bietet neue Perspektive in der Erkenntnistheorie
- er unterscheidet zwischen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More und a posterioriEigenschaft von Urteilen, die auf Basis der Erfahrung gefäl… More Erkenntnissen, was eine tiefere Analyse der Grundlagen unseres Wissens ermöglicht
- die Kategorientafel bietet eine systematische Ordnung der Begriffe, die für jede mögliche Erfahrung notwendig sind
- Unabhängigkeit von empirischer Erfahrung durch Raum und Zeit als reine Formen der Anschauung ermöglichen Erklärung, wie mathematische Erkenntnisse a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More möglich sind
- verdeutlicht die Grenzen menschlicher Erkenntnis (durch die Ideen und Antinomiensich logisch widersprechende Antworten auf die Fragen der Ve… More) und schützt so vor metaphysischen Spekulationen
- Kants Erkenntnistheorie bietet die Grundlage zum Beweis der Möglichkeit moralischen Handelns → Fundament für den kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More
- Ansatz ist komplex und theoretisch anspruchsvoll, was zu Schwierigkeiten in der praktischen Anwendbarkeit führt
- Betonung der subjektiven Bedingungen der Erkenntnis wirft die Frage auf, inwieweit objektive Erkenntnis (s. Moralgesetz) möglich ist
- Willkür der Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More: Kritiker argumentieren, dass Kants Auswahl der Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More willkürlich und nicht notwendig ist
- Problem des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More: die Annahme von Dingen an sich, die wir nicht erkennen können, wird oft als problematisch und widersprüchlich angesehen
→ Beziehung zwischen Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More und Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More bleibt unklar
Teste dein Wissen
Die KrV dreht sich um die Frage „Was kann ich wissen?“.
Das Hauptziel von Kants Werk ist es, die Grenzen und Möglichkeiten der reinen Vernunft und mit ihr der menschlichen Erkenntnis zu bestimmen.
Erkenntnisse a priori sind unabhängig von Erfahrung und gelten allgemein und notwendig, wie etwa die Mathematik. Erkenntnisse a posteriori beruhen auf Erfahrung und sind spezifisch, dadurch also nicht notwendig und nicht allgemeingültig.
Um analytische Urteile handelt es sich genau dann, wenn das Prädikat im Subjekt enthalten ist. Kant führt als Beispiel „Körper sind ausgedehnt“ an.
Damit etwas ein Körper ist, muss es eine ausgedehnte Substanz sein.
Synthetische Urteile sind genau solche, in denen Subjekt und Prädikat nicht zusammenfallen und dem Subjekt neue Informationen hinzufügen, z.B. „Der Apfel ist rot“.
Der Begriff rot gehört nicht notwendig zum Begriff des Apfels, denn es gibt bspw. auch grüne Äpfel.
Laut Kant sind es die synthetischen Urteile a priori, die das menschliche Wissen erweitern. Kant definiert sie als zusammengesetzt, unabhängig von Erfahrung und notwendig. Ein Beispiel dafür ist der mathematische Satz „5+7=12“.
Weitere Beispiele:
- „Cogito ergo sum„
- a² + b² = c²
Kant wendet die kopernikanische Wende auf den menschlichen Verstand an und postuliert, dass nicht unserer Verstand sich nach den Objekten unserer Wahrnehmung richtet, sondern die Objekte der Wahrnehmung sich nach unserem Verstand und unseren Erkenntnisbedingungen richten.
Er behauptet, die Struktur unserer Erkenntnis formt unsere Welt und definiert den Verstand als das „zentrale Maß aller Dinge„.
Die Welt des Phänomenon ist die Welt der Erfahrung, also die Welt wie sie uns erscheint, geordnet durch Raum und Zeit und die Kategorien des Verstandes.
Die Welt des Noumenon ist die Welt der Dinge an sich, die das menschliche Erkenntnisvermögen übersteigt und uns somit prinzipiell unzugänglich bleibt.
Teil der noumenalen Welt sind laut Kant die transzendentalen Ideen, die Antinomien, die Freiheit und damit auch die Existenz eines absolut geltendes Moralgesetzes.
Kant bezeichnete Raum und Zeit als reine Formen der Sinnlichkeit. Ihre Notwendigkeit folgt daraus, dass sie unseren Anschauungen a priori zugrunde liegen und wir alles nur als innerhalb des Raumes und innerhalb der Zeit existierend begreifen können.
Charakteristika von Raum und Zeit:
- Raum und Zeit sind Vorstellungen a priori und somit notwendig;
- Zeitabschnitte sind nur nacheinander und Räume nur nebeneinander denkbar;
- Es existiert nur ein Raum und nur eine Zeit, die erst der Verstand in kleinere Teile trennt;
- Als Formen der Sinnlichkeit a priori sind Raum und Zeit unendlich gegebene Größen.
„Der Raum ist eine notwendige Vorstellung, a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, daß keine Gegenstände darin angetroffen werden.“
„das Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge. Nur unter deren Voraussetzung kann man sich vorstellen: daß einiges zu einer und derselben Zeit (zugleich) oder in verschiedenen Zeiten (nach einander) sei.“
„Sie [die Zeit] hat nur eine Dimension: verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander (so wie verschiedene Räume nicht nach einander, sondern zugleich sind). Diese Grundsätze können aus der Erfahrung nicht gezogen werden. […] Diese Grundsätze gelten als Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind, und belehren uns vor derselben, und nicht durch dieselbe.„
Die Kategorien des Verstandes sind apriorische Denkformen, die unsere empirischen Anschauungen, d.h. Sinneswahrnehmungen, ordnen. Sie sind transzendental und bilden die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung.
Durch die Kategorien kann der Mensch logische Urteile bilden und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Vorgängen verstehen. Bspw. versteht der Mensch durch die Kategorie der Kausalität, dass sein Kaffee kalt geworden ist, weil er ihn so lange hat rumstehen lassen.
Hierbei ist wichtig zu verstehen, dass sich die Kategorien nicht wahrnehmen, sondern nur denken lassen, denn sie sind keine Sinneswahrnehmungen, sondern Ordnungsentitäten, die unser Verstand anwendet.
Obgleich die Kategorien genauso notwendige, apriorische Formen sind wie Raum und Zeit, sind jene grundlegend von diesen unterschieden.
Raum und Zeit sind apriorische Formen der Sinnlichkeit und ordnen allen Anschauungen (transz. Ästhetik).
Die Kategorien hingegen sind apriorische Formen des Verstandes und ordnen unser Denken und unsere Urteile (transz. Logik).
Die Antinomien der reinen Vernunft zeigen, dass die Vernunft ohne Bezug auf Erfahrung zu Widersprüchen führt. Schaut man sich z.E. die Antinomie von Raum und Zeit an, sieht man, dass die Vernunft sowohl denken kann, dass die Welt einen Anfang in der Zeit hat, als auch, dass sie keinen Anfang hat. Diese Widersprüche verdeutlichen zeigen die Grenzen menschlicher Erkenntnis.
wichtige Erkenntnisse der KrV:
1. Der Mensch kann Erkenntnis nur durch die Synthese von Erfahrung und Verstand gewinnen.
2. Sichere Erkenntnis ist in Form von analytischen und synthetischen Urteilen a priori möglich.
3. Der Mensch darf sich nicht unternehmen, das Unbedingte und Absolute (s. transzendentale Ideen & Antinomien) zu beweisen, weil er sich sonst in Widersprüchen verfängt.
→ Kants Überlegungen zeigen, dass die menschliche Erkenntnis auf die Welt der Erscheinungen beschränkt ist und wir die Dinge an sich nicht vollständig begreifen können.
Darüber hinaus legt Kant die Grundlage für den Beweis der Möglichkeit sittlichen Handelns durch die Freiheit. Er zeigte, dass die Kausalität der Natur und die Freiheit des Menschen sich nicht widersprechen, sondern nebeneinander existieren können – die Kausalität als Teil des Phänomenon, die Freiheit als Teil des Noumenon.
Lernmaterial
Einen guten Überblick zum KritizismusName für Kants Position in der Erkenntnistheorie, die den E… More bilden die folgenden Videos:
Immanuel Kant – Kritizismus | Philoworks
Immanuel Kant – Erkenntnistheorie – Transzendentalphilosophie – Abitur Wissen Philosophie und Ethik
Das merke ich mir:
1. Erkenntnis erfolgt durch die Synthese von Erfahrung und Verstand
2. Sichere Erkenntnis ist in Form von analytischen und synthetischen Urteilen a prioriEigenschaft von Urteilen, die von der Erfahrung unabhängig … More möglich
→ Dadurch kann Kant den kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More aufstellen; Die KrV bietet also eine Grundlage für den Beweis der Möglichkeit sittlichen Handelns (durch die Freiheit)
3. Der Mensch darf sich nicht unternehmen, das Unbedingte und Absolute zu beweisen, weil er sich sonst in Widersprüchen verfängt