Präferenz-Utilitarismus
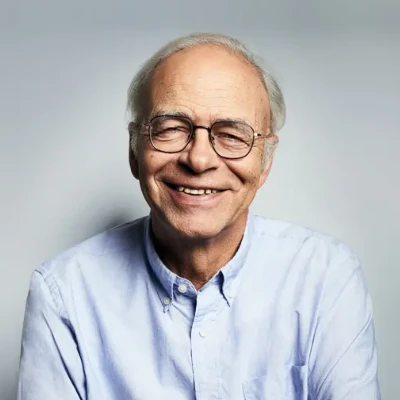
Peter Singer
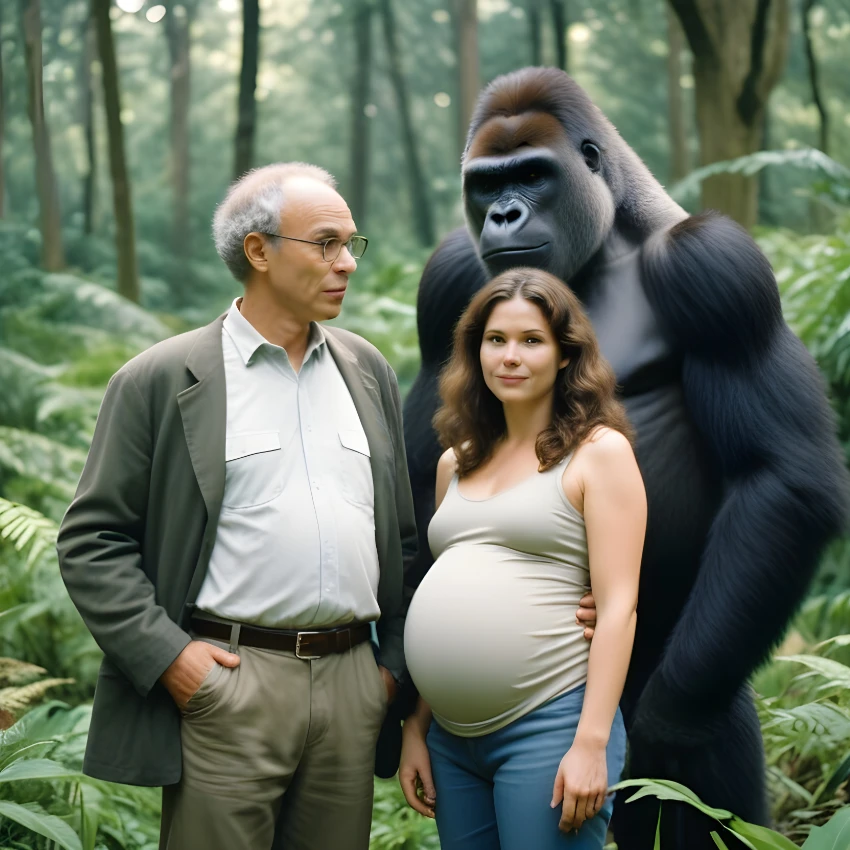
Inhalt
Biografie
Zitate
Original Textauszug
Angenommen, ich beginne dann, so weit moralisch zu denken, dass ich mich in die Lage der anderen versetze, die von meiner Entscheidung betroffen sind. Um zu wissen, wie es ist, sich in ihrer Lage zu befinden, muss ich den Standpunkt ihrer Präferenzen einnehmen – ich muss mir vorstellen, wie hungrig sie sind, wie sehr sie die Früchte genießen würden usw. Nachdem ich das getan habe, muss ich, wenn ich in ethischen Maßstäben denke, erkennen, dass ich nicht meinen eigenen Präferenzen größeres Gewicht als denen anderer beimessen kann, nur weil es meine eigenen sind. Also muss ich nun anstelle meiner eigenen Präferenzen die all der anderen berücksichtigen, die von meiner Entscheidung betroffen sind. Wenn es nicht irgendwelche weiteren ethisch relevanten Gesichtspunkte gibt, wird mich das dazu bringen, sämtliche vorhandenen Präferenzen abzuwägen und jenen Handlungsverlauf zu wählen, von dem es am wahrscheinlichsten ist, dass er die Präferenzen der Betroffenen weitestgehend befriedigt. […]
Die hier skizzierte Denkweise ist […] unter dem Namen „Präferenz-Utilitarismus“ bekannt, weil sie behauptet, dass wir das tun sollten, was per saldo die Präferenzen der Betroffenen fördert. […]
Nach dem Präferenz-Utilitarismus ist eine Handlung, die der Präferenz irgendeines Wesens entgegensteht, ohne dass diese Präferenz durch entgegengesetzte Präferenzen ausgeglichen wird, moralisch falsch. Eine Person zu töten, die es vorzieht, weiterzuleben, ist daher, gleiche Umstände vorausgesetzt, unrecht.
[…] Dass die Opfer nach der Ermordung nicht mehr da sind, um sich darüber zu beklagen, dass ihre Präferenzen nicht beachtet worden sind, ist unerheblich.
Das Unrecht liegt darin, dass ihre Präferenz vereitelt worden ist.
Für Präferenz-Utilitaristen ist die Tötung einer Person in der Regel schlimmer als die Tötung eines anderen Wesens, weil Personen in ihren Präferenzen sehr zukunftsorientiert sind. Eine Person zu töten bedeutet darum normalerweise nicht nur eine, sondern eine Vielzahl der zentralsten und bedeutendsten Präferenzen, die ein Wesen haben kann, zu verletzen. Sehr oft wird dadurch alles, was das Opfer in den vergangen Tagen, Monaten oder sogar Jahren zu tun bemüht war, ad absurdum geführt. Im Gegensatz dazu kann ein Wesen, das sich nicht selbst als eine Entität mit einer eigenen Zukunft sehen kann, keine Präferenz hinsichtlich seiner eigenen zukünftigen Existenz haben.
Damit wird nicht bestritten, dass ein solches Wesen gegen eine Situation ankämpfen kann, in der sein Leben in Gefahr ist, so wie ein Fisch kämpft, um sich von dem Angelhaken in seinem Maul zu befreien; aber dies bezeichnet lediglich eine Präferenz für das Aufhören des Zustandes, der Schmerz oder Angst verursacht. Das Verhalten des Fisches legt es nahe, Fische nicht mit der Methode zu töten, aber es liefert keinen präferenz-utilitaristischen Grund dagegen, Fische mit einer Methode zu töten, die sofort zum Tode führt, ohne Schmerz und Leid zu verursachen.
Einige nichtmenschliche Tiere scheinen sich selbst als distinkte Wesen mit einer Vergangenheit und Zukunft zu begreifen. […] Bei den großen Menschenaffen handelt es sich vermutlich am eindeutigsten um Personen, aber […] auch bei einigen anderen Spezies [gibt es] Anzeichen für das Vorhandensein von in die Zukunft gerichteten Bewusstseinsvorgängen. […]
Ich legte dar, dass dann, wenn den meisten menschlichen Wesen ein Leben von besonderer Bedeutsamkeit eignet oder sie einen besonderen Anspruch auf Schutz ihres Lebens haben, dies mit der Tatsache in Zusammenhang gesehen werden muss, dass die meisten menschlichen Wesen Personen sind. Falls aber einige nichtmenschliche Tiere ebenfalls Personen sind, dann hat ihr Leben denselben Schutzanspruch. […]
Daher sollten wir die Lehre, dass die Tötung von Angehörigen unserer Gattung immer größere Bedeutsamkeit hat als die Tötung von Angehörigen anderer Gattungen, ablehnen. Manche Angehörigen anderer Gattungen sind Personen; manche Angehörigen unserer eigenen Spezies sind es nicht.
Peter Singer: Practical Ethics / Praktische Ethik. 3. Auflage (2013). Aus dem Englischen übersetzt von Oscar Bischoff / Jean Claude Wolf / Dietrich Klose / Susanne Lenz. Reclam, Stuttgart 2013. S. 39-40, 41, 52-53, S. 137, 139f., 141, 142, S. 143, 145f., 151-152, S. 218, 186, 185f.
Lernzettel
Theorieeinordnung:
- Singer ist Vertreter des Präferenz-Utilitarismus, einer teleologischen Ethik; er lehnt den SpeziesismusSpeziesismus bezeichnet die moralische Diskriminierung von L… More vollständig ab.
Problemfrage:
- Wie soll ich (moralisch) handeln? Wie lässt sich die Moralität einer Handlung bewerten?
Lösung:
- Eine Handlung ist genau dann moralisch, wenn sie möglichst viele Präferenzen aller Betroffenen befriedigt. Dazu wird objektiv danach beurteilt, wie selbstbewusst ein Wesen ist, d.h. ob es eine distinkte EntitätWesen, welches über Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkei… More ist oder nicht.
Argumentation:
- Ziel ist die maximale Erfüllung der Präferenzen der betroffenen Individuen einer Handlung
- Voraussetzung dafür ist die Berücksichtigung aller Individuen (UniversalitätsprinzipPrinzip, das besagt, jedes von der Handlung betroffene Indiv… More)
→ notwendige Erweiterung: Ausgleich zuvor missachteter Präferenzen → wird die PräferenzEine Präferenz umfasst die individuellen Bedürfnisse, Wün… More eines Individuums missachtet, ist dieses Individuum zukünftig bevorzugt zu behandeln - Bewertung der Moralität: Interessen sowie ethische Relevanz entscheiden sich je nach Klasse von Wesen; Personen haben die höchste ethische Relevanz
- Klassifizierung der Wesen:
1. Wesen ohne Bewusstsein & ohne Zentralnervensystem: kein Lust- oder Schmerzempfinden; haben keine (ethischen) Werte an sich → Mensch hat keine Verpflichtung ihnen gegenüber (z.B. Tischlampe, Pflanze, Seestern, Embryo)
2. bewusst-empfindende Wesen: können Lust bzw. Schmerz empfinden → klassisch-utilitaristische Behandlung; sind individuell austauschbar, da sie keine distinkten Entitäten sind; zweitrangige moralische Verpflichtung (z.B. Tiere mit ZNS, Neugeborene, Schwerstbehinderte)
3. selbstbewusste Wesen bzw. Personen: distinkte Entitäten bzw. Personen; selbstbewusste, empfindungsfähige und autonome Wesen, die sich selbst in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als die selbe Person begreifen; unbedingt moralische Verpflichtung (z.B. Menschenaffen, die meisten Menschen, Delfine) - jedoch legitim ist die Tötung von Wesen, die keine distinkte EntitätWesen, welches über Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkei… More sind → ein am Haken hängender Fisch, kämpft nur um sein Leben, weil er die Schmerzen beenden will, nicht weil er den bewussten Wunsch hat, weiterzuleben
→ Sind in einer Handlungssituation Individuen mehrerer Klassen beteiligt, haben Präferenzen höher klassifizierter Wesen einen höheren Wert bei der Entscheidungsfindung - Fazit: Singers klassifiziert mit seinem Präferenz-Utilitarismus den moralischen Wert aller Lebewesen und plädiert für eine objektive Bewertung der Moralität, bei der der ethische Wert eines Lebewesens von dessen Klassifizierung abgeleitet wird. Moralisch handeln bedeutet für Singer, die Präferenzen aller betroffenen Wesen zu berücksichtigen, wobei Personen, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More distinkte Entitäten, priorisiert werden, da ihre AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More und ihr Lebenswille die höchste ethische Relevanz besitzen.
Schaubild
Klausurtext
Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.
Viel Erfolg beim Lernen!
Der australische Philosoph Peter Singer verfasste bezüglich der Kernfrage der Ethik, die nach dem moralisch richtigen Handeln des Menschen fragt, eine eigene Ethik – den Präferenzutilitarismus.
Das Ziel seiner teleologischen Ethik ist die maximale Erfüllung der Interessen beziehungsweise Präferenzen aller Betroffenen einer Handlung, womit er ein universalistisches Prinzip verfolgt. Unter Interessen der Betroffenen versteht Singer alle rationalen und zukunftsorientierten Interessen. Bei der ethischen Entscheidung müssen Singer zufolge alle Interessen aller Individuen berücksichtigt werden, um keine PräferenzEine Präferenz umfasst die individuellen Bedürfnisse, Wün… More zu vernachlässigen.
Da es bei einer klassisch-utilitaristischen Entscheidung allerdings unvermeidbar sei, dass Interessen vernachlässigt werden, sei es notwendig, einen Ausgleich von zuvor missachteten Präferenzen zu finden. Diese Voraussetzung müsse erfüllt sein, damit nicht immer dieselbe Gruppe leide. Aus diesem Grund müssten ebendiese missachteten Interessen bei der nächsten Entscheidung bevorzugt werden. Die Entscheidung über die Interessen müsse dabei unparteiisch getroffen werden.
Laut Singer sind allerdings nicht alle Interessen von gleichem Wert, weshalb er in Folge eine Klassifizierung der Lebewesen vornimmt und sie in drei Klassen unterteilt.
In der ersten Klasse würden sich alle Entitäten ohne Bewusstsein, d.h. ohne ein ausgebildetes zentrales Nervensystem, befinden. Diese können weder Lust noch Schmerz empfinden, weshalb sie Singer zufolge keine ethischen Werte an sich hätten und der Mensch folglich keine Verpflichtung ihnen gegenüber habe.
Über den Entitäten ohne Bewusstsein würden alle bewusst-empfindende Wesen stehen, worunter Singer u.a. Tiere mit zentralem Nervensystem, Neugeborene und Schwerstbehinderte fasst – eben alle Lebewesen, die Lust und Schmerz empfinden. Bewusst-empfindende Wesen müssten dementsprechend klassisch-utilitaristisch behandelt werden, also mit dem Ziel, das größtmögliches Glück für größtmögliche Anzahl zu erreichen. Alle Lebewesen dieser Klasse seien jedoch individuell austauschbar, da sie keine distinkten Entitäten, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More über sich selbst und ihr Handeln bewusste Wesen, seien.
Die dritte und höchste Klasse sei die aller selbstbewusster Wesen beziehungsweise Personen. Personen seien deshalb von höherem Wert als alle anderen Lebewesen, weil sie distinkte Entitäten seien. Dazu zählen alle Lebewesen, die Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit und AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More aufweisen. Das bedeutet, sie müssen die Fähigkeit haben, sich ihrer selbst bewusst sowie empfindungsfähig zu sein und darüber hinaus müssen sie sich selbst als über ihre Zeit existierend und von sich selbst abgegrenzt begreifen können.
Liegen diese Fähigkeiten vor, handele es sich um eine distinkte EntitätWesen, welches über Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkei… More, welche präferenz-utilitaristisch behandelt werden müsse. Menschenaffen und einige weitere Spezies verfügen nach Singer über ein Selbstbewusstsein und seien somit distinkte Entitäten.
Außerdem hätten sie Singer zufolge ein individuelles Recht auf Leben und folglich das meiste Gewicht in einer ethischen Entscheidung.
Demgemäß seien alle Handlungen unmoralisch, bei denen die Präferenzen einer Person missachtet und nicht weiterführend in irgendeiner Form ausgeglichen würden oder wenn eine Person getötet werde, die weiterleben wollte, denn damit würden die bedeutendsten Präferenzen dieser Person verletzt. Auf der anderen Seite sei es legitim, Wesen zu töten, die keine distinkten Entitäten seien wie beispielsweise ein Fisch, da dieser nur um sein Leben kämpfe, um den Schmerz zu beenden und nicht, weil er den bewussten Wille habe, weiterzuleben.
Folglich lässt sich als Definition moralischen Handelns nach Singer festhalten, dass eine Handlung genau dann moralisch gut sei, wenn möglichst viele Präferenzen aller Betroffenen befriedigt würden und dazu nicht die eigene Spezies bevorzugt, sondern objektiv danach beurteilt werde, wie selbstbewusst ein Wesen ist, d.h. ob es eine Person und somit eine distinkte EntitätWesen, welches über Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkei… More ist oder nicht.
Singer entwickelt somit einen konsequent universalistischen Ansatz, der moralische Verpflichtungen an Präferenzen und nicht an Spezieszugehörigkeit knüpft. Entscheidend ist der Grad des Selbstbewusstseins, wobei Personen als distinkte Entitäten besonderen Schutz verdienen.
(Anna-Marie H. – LK MH 2024)
Peter Singer ist ein australischer Philosoph und Ethiker, der sich mit der Frage nach dem moralisch richtigen Handeln des Menschen beschäftigt hat. Dazu stellt er seinen Präferenzutilitarismus auf, welcher als teleologische Ethikfolgeorientierte bzw. zweckorientierte Ethik
(von griech…. More einzuordnen ist. Singers Ziel ist es, die Präferenzen aller Betroffenen einer Handlung maximal zu erfüllen.
Auf dieser Basis definiert er eine moralische Handlung. Moralisch ist nach ihm eine Handlung, die möglichst viele Präferenzen aller Betroffenen befriedigt. Dazu dürfe die eigene Spezies nicht bevorzugt werden, denn es müsse objektiv danach beurteilt werden, wie selbstbewusst ein Wesen ist. Dabei sei das Selbstbewusstsein entscheidend dafür, ob es sich bei einem Lebewesen um eine Person handle oder nicht.
Da in Singers Ethik die Interessen aller Individuen berücksichtigt werden müssen, verfolgt er mit seiner Position das UniversalitätsprinzipPrinzip, das besagt, jedes von der Handlung betroffene Indiv… More. Eine ausschließlich klassisch-utilitaristische Abwägung genüge laut Singer jedoch nicht, da man so Gefahr laufe, dass häufig dieselben Menschen bzw. Gruppen leiden. Deshalb müsse bei der Entscheidungsfindung darauf geachtet werden, dass zuvor missachtete Präferenzen ausgeglichen werden, damit nicht immer dieselbe Gruppe leide. Diejenige Gruppe, die unter der vorherigen Handlung am meisten gelitten hat, müsse dann bei der nächsten Handlung besonders berücksichtigt werden.
Weiter argumentiert er, die Wichtigkeit der Interessen und der Wert von Lebewesen unterscheide sich in Bezug auf ihre Klassenzugehörigkeit, weshalb er eine Klassifizierung vornimmt, in der die Lebewesen in drei Klassen einteilt: Die erste Klasse repräsentiere alle Wesen ohne Bewusstsein, also Wesen ohne Zentralnervensystem. Diese hätten aufgrund ihrer fehlenden Lust- bzw. Schmerzempfindung keine ethischen Werte an sich. Daraus folgt, so Singer, dass der Mensch ihnen gegenüber keine Verpflichtung habe.
Zur zweiten Klasse würden alle bewusst-empfindenden Wesen zählen. Diese seien somit in der Lage, Lust und Schmerz zu empfinden. Aus diesem Grund müssten sie klassisch-utilitaristisch bewertet werden und seien zudem individuell austauschbar, da sie keine distinkten Entitäten seien. Zu den Lebewesen zweiter Klasse würden z.B. Tiere mit Zentralnervensystem, Neugeborene und Schwerstbehinderte zählen.
Lebewesen dritter Klasse seien selbstbewusste Wesen bzw. Personen. Singer bezeichnet Personen auch als distinkte Entitäten, da sie Fähigkeiten Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit und AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More aufwiesen. Dadurch seien sie sich ihrer selbst bewusst und würden sich über Ihre Existenz hinaus begreifen, wie bspw. Menschenaffen.
Abschließend definiert Singer die Eigenschaften einer unmoralischen Handlung. Unmoralisch seien Handlungen genau dann, wenn durch sie die Präferenzen der Betroffenen ignoriert beziehungsweise sie nicht weiterführend ausgeglichen würden. Zu einer solche unmoralischen Handlung zähle auch die Tötung distinkter Entitäten, da das die Verletzung der bedeutendsten Präferenzen dieser Person bedeute. Hingegen sei es legitim, Wesen niederer Klasse, wie beispielsweise einen Fisch, zu töten, da ein Fisch nicht den Willen habe, weiterzuleben, sondern nur, den Schmerz zu beenden.
Singer vertritt einen präferenzutilitaristischen Ansatz, der die Berücksichtigung aller Interessen fordert, aber eine Hierarchie nach Selbstbewusstsein etabliert. Moralisch handeln bedeutet für ihn, Personen (distinkte Entitäten) besonders zu schützen, während nicht-selbstbewusste Wesen individuell austauschbar sind.
(Laura W. – LK MH 2025)
Der australische Philosoph Peter Singer verfasste bezüglich der Kernfrage der Ethik nach dem moralisch richtigen Handeln des Menschen seine eigene Theorie – den Präferenzutilitarismus, welche eine teleologische Ethikfolgeorientierte bzw. zweckorientierte Ethik
(von griech…. More ist.
Seine Position liegt der Frage zugrunde, ob in ethischen Entscheidungen die menschliche Spezies bevorzugt werden dürfe oder man eher danach streben sollte, die Präferenzen aller Betroffenen unabhängig der Spezies bestmöglich zu erfüllen.
Da er eine utilitaristische Position vertritt, ist das Ziel seiner Ethik die maximale Erfüllung der Interessen bzw. Präferenzen aller Betroffenen einer Handlung.
Somit sei moralisches Handeln laut Singer die Befriedigung möglichst vieler Präferenzen aller Betroffenen, wobei nicht die eigene Spezies bevorzugt werden, sondern objektiv danach beurteilt werden müsse, wie selbstbewusst ein Wesen ist, d.h. ob es eine distinkte EntitätWesen, welches über Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkei… More ist oder nicht.
Weiterführend ergänzt Singer, sei es notwendig, bei Missachtung einer PräferenzEine Präferenz umfasst die individuellen Bedürfnisse, Wün… More einen Ausgleich für den Betroffenen zu schaffen. Auch dürfe es nicht passieren, dass immer die gleichen leiden, sondern müssten die Präferenzen ebendieser Lebewesen bei der nächsten Handlung bevorzugt werden.
Nach Singer unterscheide sich der Wert je nach Klasse und teilt deshalb alle Lebewesen in drei Klassen ein.
In der ersten Klasse seien alle „Wesen ohne Bewusstsein“. Diese hätten kein ausgebildetes Zentralnervensystem, könnten also weder Lust noch Schmerz empfinden. Somit haben sie Singer zufolge keinen ethischen Wert an sich und der Mensch habe ihnen gegenüber keine Verpflichtung.
Die zweite Klasse sei die der „bewusst-empfindenden Wesen“. Wesen dieser Klasse könnten Lust und Schmerz empfinden wie z.B. Tiere mit ZNS, Neugeborene und Schwerstbehinderte, so Singer. Ihre Präferenzen könne man klassisch-utilitaristisch bewerten, da sie nicht in die Zukunft denken könnten und individuell austauschbar seien.
Die letzte Klasse sei die der „selbstbewussten Wesen“ beziehungsweise „Personen“. Bei diesen handele es sich um distinkte Entitäten, denn sie würden Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit und AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More aufweisen. Wesen dritter Klasse wie z.B. Menschen ab einem bestimmten Alter oder Menschenaffen seien sich also über ihrer selbst bewusst und begreifen sich selbst als über ihre Zeit existierend und von sich selbst abgegrenzt.
Personen müssten laut Singer folglich präferenzutilitaristisch bewertet werden und dürften darüber hinaus auch nicht gegen ihren Willen getötet werden, da dies die bedeutendsten Präferenzen dieser Person verletzen würde.
Singer entwickelt somit einen konsequent universalistischen Ansatz, der moralische Verpflichtungen an Präferenzen und nicht an Spezieszugehörigkeit knüpft. Entscheidend ist der Grad des Selbstbewusstseins, wobei Personen als distinkte Entitäten besonderen Schutz verdienen.
(Lea S. – LK VD 2024)
Tragfähigkeit
- unterstreicht die moralische Bedeutung des Leidens aller Lebewesen, was lobenswert ist, da alle Lebewesen Teil dieser Welt sind → fordert uns auf, die Bedürfnisse aller leidensfähigen Wesen zu berücksichtigen
→ Schutz vor Verrohung des Menschen und Sensibilisierung - Es ist sinnvoll, denjenigen Lebewesen den größten Wert zuzuschreiben, die am meisten unter der Entscheidung zu leiden hätten → (distinkte Entitäten sowohl physisch als auch psychisch)
- Prinzip der Präferenzmaximierung ermöglicht eine leichten Vergleich verschiedener Handlungsalternativen und eine leichte moralische Entscheidung
- Kommunikation mit Tieren und das Verstehen ihrer inneren Vorgänge ist kaum möglich → Messung und Vergleich von Präferenzen verschiedener Lebewesen ist problematisch → kann zu subjektiven Bewertungen und verfälschten Entscheidungen führen
- genaue Anleitung zum moralischen Handeln wie das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül oder der kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Imperativ sie bieten, fehlt → z.B. ist unklar, wie widersprüchliche Präferenzen verschiedener Individuen gewichtet und priorisiert werden sollten → Gefahr besteht, dass die Interessen der Mehrheit über die Interessen der Minderheit dominieren und zu ungerechten Ergebnissen führen
- Mensch ist das einzige Lebewesen, welches einen (vollkommen) autonomen Willen besitzt und nicht von Naturtrieben oder Gesetzen abhängig ist → Affen verfügen zwar über eine gewisse Vernunftbegabung, sind teilweise aber von ihren Naturtrieben abhängig (z.B. Unbeherrschtheit bei Nahrung, kaum vorhandene Moral) → es hat also wenig Sinn, Affen und Menschen der gleichen Klasse zuzuordnen, da der Mensch über weitaus mehr AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More und Moral verfügt → Folge der Evolution: mannigfaltige Unterschiede → auch innerhalb einer Klasse treten kognitive und körperliche Unterschiede auf, die den Wert des Lebewesens verändern könnten
- nur Menschen sind in der Lage dazu, Singers Ethik zu verstehen und zu verfolgen → er schließt aber auch andere Lebewesen mit ein, die nicht in der Lage dazu sind, seine Ethik zu verfolgen
→ Warum sollte der Mensch nach einer Ethik handeln, in denen auch Tiere einen Wert haben, wenn ebendiese aber nicht danach handeln können? - Unmöglichkeit eines Universalgesetzes
Teste dein Wissen
teleologische Ethik
– klassischer Utilitarismus verfolgt nur die Interessen der Mehrheit; Präferenzutilitarismus verlangt einen Ausgleich zuvor vernachlässigter Präferenzen
– Singer unterteilt Lebewesen in 3 Klassen, von denen die distinkten Entitäten am meisten wiegen; im klassischen Utilitarismus nach Bentham haben alle Menschen den gleichen Wert
– Präferenzutilitarismus legt den ethischen Wert eines Lebewesen auf Basis seiner Leidensfähigkeit fest; klassischer Utilitarismus addiert Freude bzw. Leid & geht der Handlung nach, die die Freude maximiert bzw. das Leid minimiert
Eine Handlung ist genau dann moralisch, wenn möglichst viele Präferenzen aller Betroffenen befriedigt werden. Dazu darf nicht die eigene Spezies bevorzugt, sondern es muss objektiv beurteilt werden, wie selbstbewusst ein Wesen ist, d.h. ob es eine distinkte Entität ist oder nicht.
Er verfolgt das für den Utilitarismus typische Universalitätsprinzip, was alle von einer Handlung Betroffenen mit einschließt.
Ein Lebewesen ist genau dann eine distinkte Entität (oder auch: Person), wenn es Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit & Autonomie aufweist.
Klassisch-utilitaristische Entscheidungen führen zu der Vernachlässigung von Minderheiten. Deshalb muss ein Ausgleich der zuvor missachteten Präferenzen gefunden werden, damit nicht immer dieselbe Gruppe leidet.
Singer ist der Meinung, dass das menschliche Leben nicht heilig ist. Nicht allein der Mensch verdiene es, moralische Rechte zu besitzen, mithin verdiene auch er sie nur, wenn er für sich beanspruchen kann, eine distinkte Entität zu sein, d.i. empfindungsfähig und selbstbewusst ist.
- Wesen ohne Bewusstsein, d.h. Wesen ohne ausgebildetes Zentralnervensystem, da sie keine Lust- oder Schmerzempfindung besitzen & somit keine (ethischen) Werte an sich hätten
- bewusst-empfindende Wesen, denn sie können Lust/Schmerz empfinden und müssten somit klassisch-utilitaristisch behandelt werden. Sie seien aber individuell austauschbar, da sie keine distinkte Entitäten sind (z.B. Tiere mit ZNS, Neugeborene, Schwerstbehinderte)
- selbstbewusste Wesen/Personen, d.i. distinkte Entitäten, denn Personen weisen Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit & Autonomie auf
Eine Handlung ist nach Singer genau dann unmoralisch, wenn nicht nach der Erfüllung der größtmöglichen Zahl von Präferenzen entschieden wird und zusätzlich wenn Präferenzen ignoriert werden oder es keinen weiterführenden Ausgleich der zuvor missachteten Präferenzen gibt.
weil sie sich ihre Zukunft nicht vorstellen können (wie z.B. einen Fisch) und nur um ihr Leben kämpfen, um den Schmerz zu beenden und nicht aufgrund des bewussten Willens weiterzuleben. Daher dürfen sie nach Singer schmerzfrei getötet werden.
Der Mensch zeichnet sich durch seinen autonomen Willen & seine Fähigkeit, moralisch zu handeln aus; diese Eigenschaften sind bei Tieren nicht bzw. kaum vorhanden. Außerdem haben unterschiedliche Arten (Evolution) unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt, und besitzen somit unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeiten.
Nach Singer wäre es so theoretisch legitim, Babys oder Behinderte schmerzfrei zu töten, was im Hinblick auf die Menschenwürde fraglich ist.
Lernmaterial
Einen guten Überblick zum Präferenz-Utilitarismus bildet das folgende Video:
Peter Singer | Präferenzutilitarismus und Person-Begriff
Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:
Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.
https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/